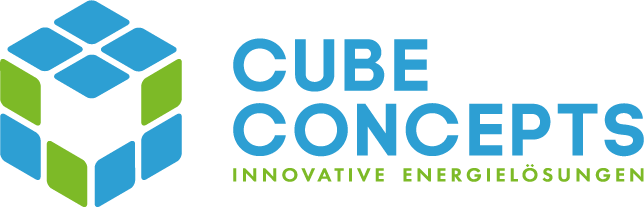In den kommenden Tagen wird der Monitoringbericht zur Energiewende erwartet, den das Energiewirtschaftliche Institut (EWI) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erstellt. Schon im Vorfeld wird über den Bericht intensiv diskutiert. Kritiker befürchten, dass die Analyse vor allem dazu dienen könnte, den Ausbau erneuerbarer Energien zu bremsen und den offenbar bereits geplanten Bau von Gaskraftwerken zu rechtfertigen. Parallel zum laufenden Prozess sind jetzt mehrere Studien erschienen, die mögliche Folgen eines verlangsamten Ausbaus von Photovoltaik und Windkraft untersuchen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass ein Abbremsen erhebliche Risiken für Klimaschutz, Energiekosten und Versorgungssicherheit mit sich bringen würde.
Folgen eines verlangsamten Ausbaus
Eine von Greenpeace und Green Planet Energy beauftragte Kurzstudie des Beratungsunternehmens Enervis Energy Advisors analysiert unterschiedliche Entwicklungspfade für den Zeitraum bis 2035. Ausgangspunkt ist das Referenzszenario, das sich an den bisher gesetzten Zielen orientiert. Lt. EEG 2023 sind dies: 215 Gigawatt Photovoltaik-Leistung und 145 Gigawatt Windenergie bis 2030 sowie ein starker Hochlauf bei Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen. Um dies zu erreichen, ist ein jährlicher Zuwachs von 22 Gigawatt Solarleistung geplant. Dieses Szenario vergleicht Enervis mit Varianten, die einen deutlich langsameren Ausbau sowohl bei erneuerbaren Energien als auch bei der Elektrifizierung unterstellen.
Die Ergebnisse zeigen: Während sich die Unterschiede im Stromsektor zunächst noch in Grenzen halten, steigen die CO₂-Emissionen in Verkehr und Wärme deutlich an, sofern man dort länger auf fossile Energien setzt. Bis 2035 summieren sich die zusätzlichen Emissionen auf bis zu 381 Millionen Tonnen. Hinzu kämen noch weiter 62 Millionen Tonnen, wenn der Stromverbrauch steigt und der Ausbau der erneuerbaren Energien stockt. Diesen Wert kalkulieren die Experten bei einer zusätzlichen Stromproduktion von 10 TWh aus Gaskraftwerken. Umgekehrt und ohne zusätzliche Gas- und Kohleverstromung ließen sich sogar rund 76 Millionen Tonnen CO₂ vermeiden.
Neben den Klimawirkungen verdeutlicht die Studie auch die wirtschaftlichen Risiken eines verlangsamten Ausbaues. Allein durch den europäischen Emissionshandel könnten schon 2030 Mehrkosten von bis zu 8,4 Milliarden Euro jährlich entstehen. Die gesellschaftlichen Klimakosten, berechnet auf Basis von Daten des Umweltbundesamts, summieren sich bis 2035 auf bis zu 128 Milliarden Euro.

Kosteneffizienz als politischer Maßstab im Monitoringbericht zur Energiewende
Das BMWK hat den Monitoringbericht zur Energiewende mit einem starken Fokus auf Kosteneffizienz beauftragt. Umweltorganisationen wie Germanwatch kritisieren, dass diese Sichtweise die langfristigen Klimafolgen und gesamtwirtschaftlichen Kosten unzureichend abbildet. Zwar ließen sich durch eine Verlangsamung kurzfristig Investitionen reduzieren, doch würden im Gegenzug Strafzahlungen an die EU, steigende Preise für CO₂-Zertifikate und höhere Abhängigkeiten von fossilen Importen entstehen.
Die Enervis-Studie verdeutlicht diesen Zielkonflikt: Szenarien mit gebremstem Ausbau führen nicht nur zu höheren Emissionen, sondern auch zu zusätzlichen Kosten für Staat, Unternehmen und Verbraucher. Demgegenüber senkt ein ambitionierter Ausbau erneuerbarer Energien langfristig die Importabhängigkeit und schafft Spielräume für sinkende Strompreise.
Analyse von Agora Energiewende
Einen ähnlichen Befund legt die Denkfabrik Agora Energiewende in einer eigenen Untersuchung vor. Sie vergleicht zwei Szenarien für die Entwicklung bis 2030 und hebt vier zentrale Stellschrauben hervor: eine beschleunigte Elektrifizierung, der gezielte Ausbau von Flexibilitäten, eine effiziente Netzplanung sowie der ambitionierte Ausbau erneuerbarer Energien.
Nach Berechnungen von Agora könnten in einem ambitionierten Szenario bis 2030 zusätzlich 36 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden – im Vergleich zu einem Pfad mit gebremstem Ausbau. Gleichzeitig würden sich fossile Energieimporte im Wert von bis zu sieben Milliarden Euro jährlich vermeiden lassen. Darüber hinaus erwartet die Analyse, dass der Ausbau von Wind- und Solarenergie die Strompreise bis 2030 um bis zu 23 Prozent senken könnte.
Damit verbunden ist die Botschaft, dass eine schwächere Stromnachfrage nicht als Begründung für einen langsameren Ausbau erneuerbarer Energien dienen sollte. Vielmehr sei es erforderlich, die Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Industrie voranzubringen und die Netze frühzeitig fit für den steigenden Strombedarf zu machen.

Ausblick zum Monitoringbericht zur Energiewende
Die anstehenden energiepolitischen Entscheidungen werden maßgeblich darüber bestimmen, ob Deutschland seine Klimaziele erreicht und zugleich seine Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Man darf gespannt sein, welche Schlüsse das BMWK aus dem Monitoringbericht zur Energiewende des EWI zieht. Die bereits vorliegenden Studien zeigen jedenfalls, dass ein verlangsamter Ausbau erneuerbarer Energien erhebliche klimapolitische und wirtschaftliche Nachteile hätte. Ein ambitionierter Kurs bei Wind- und Solarenergie bietet dagegen die Chance, Emissionen zu reduzieren, Kosten im Emissionshandel zu vermeiden und die Abhängigkeit von fossilen Importen zu verringern.
Vor diesem Hintergrund erscheint es entscheidend, den Monitoringbericht zur Energiewende nicht allein unter Kostengesichtspunkten zu interpretieren, sondern auch die langfristigen Risiken und Chancen in den Blick zu nehmen.