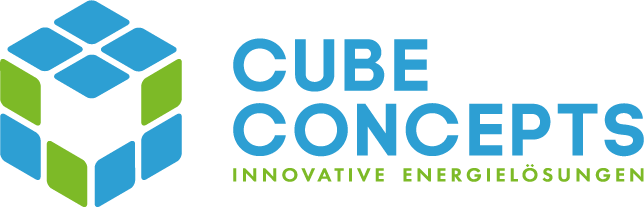Der Redispatch ist der zentrale Mechanismus, um die Stabilität des elektrischen Versorgungssystems sicherzustellen. Anders als bei der reinen Lastdeckung, bei der es darum geht, Erzeugung und Verbrauch mengenmäßig auszugleichen, zielt der Redispatch darauf ab, Netzengpässe zu vermeiden. Hintergrund: Strom fließt physikalisch nicht entlang von Marktwegen, sondern über die Leitungen, die ihm nach den Gesetzen der Elektrotechnik den geringsten Widerstand bieten. Dadurch können einzelne Netzabschnitte überlastet werden, selbst wenn im Gesamtsystem ausreichende Kapazitäten vorhanden sind.
Beim Redispatch greifen Netzbetreiber gezielt in die Einsatzplanung von Stromerzeugern – und zunehmend auch von flexiblen Verbrauchern und Speichern – ein. Sie reduzieren zum Beispiel die Einspeisung vor einem überlasteten Netzabschnitt und erhöhen sie hinter diesem Engpass. So werden Lastflüsse umgelenkt, ohne dass sich die Gesamtmenge der erzeugten Energie wesentlich ändert.
In der Praxis ist Redispatch daher kein „Notfall-Abschalten“, sondern ein geplantes, oft täglich vorberechnetes Engpassmanagement. Es wird sowohl im Day-Ahead-Bereich (Planung für den Folgetag) als auch kurzfristig im Intraday- und Echtzeitbetrieb eingesetzt.
Mit dem wachsenden Anteil volatiler Erzeugung aus Wind- und Photovoltaikanlagen sowie dem verzögerten Netzausbau steigt die Bedeutung des Redispatch kontinuierlich. Er ist inzwischen ein unverzichtbares Instrument, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Umbau des Energiesystems voranzutreiben.
Vom Redispatch 1.0 zu 2.0
Den Redispatch 1.0 gab es in Deutschland ab etwa 2010. Er diente ursprünglich ausschließlich als Steuerungsinstrument für konventionelle Großkraftwerke mit einer Leistung ab 10 MW. Grundlage bildeten § 13 EnWG sowie die Netz- und Systemregeln der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). Der Prozess war vergleichsweise überschaubar: Die ÜNBs identifizierten Engpässe, stimmten sich mit den betroffenen Kraftwerksbetreibern ab und passten deren Fahrpläne an. Die Eingriffe erfolgten überwiegend im Day-Ahead-Zeitraum und wurden über die Einsatzplanung der Kraftwerke koordiniert.
Der Übergang zum Redispatch 2.0
Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien und den geänderten Flussrichtungen im Übertragungsnetz nahm jedoch der Bedarf an Engpassmaßnahmen stark zu. Bereits vor 2020 wurden regelmäßig mehrere Terawattstunden pro Jahr umdisponiert – mit steigenden Kosten im dreistelligen Millionenbereich. Daher trat im Oktober 2021 der erweiterte Mechanismus Redispatch 2.0 in Kraft. Die zentrale Änderung:
- Einbeziehung erneuerbarer und KWK-Anlagen ab 100 kW in den Redispatch-Prozess.
- Verpflichtung zur Bereitstellung von Einspeiseprognosen, Nichtverfügbarkeitsmeldungen und Fernsteuerbarkeit.
Damit wurde der Redispatch zu einem netzebenenübergreifenden Instrument, das nicht nur große konventionelle Kraftwerke, sondern auch tausende kleinere Anlagen in Verteilnetzen einschließt. Neben den ÜNB sind seitdem auch Verteilnetzbetreiber (VNB) aktiv in die Koordination eingebunden.
Regulatorischer Rahmen
Der Redispatch ist eingebettet in ein Geflecht aus Gesetzen und Verordnungen, darunter:
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) – rechtliche Basis für Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen.
- Maßnahmenverordnung Strom – Konkretisierung zulässiger Eingriffe.
- Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG) – strategischer Kontext im Rahmen des Netzausbaus.
- Marktstammdatenregister (MaStR) – zentrale Datenbasis für Anlagenstammdaten.
Kostenentwicklung & Bedeutung
Die Ausweitung von Redispatch-Maßnahmen führte zu einem deutlichen Anstieg der Eingriffe und Kosten.
- 2021: Redispatch-Kosten erreichten in Deutschland über 600 Mio. Euro – ein Rekordwert.
- Seitdem: Tendenz steigend, da Netzengpässe und volatile Einspeisung zunehmen. Allein in 2022 und 2023 erreichten die Kosten jährlich rd. 2,5 Milliarden Euro.
Damit ist Redispatch längst nicht mehr ein selten genutztes Spezialinstrument, sondern ein Dauerwerkzeug des Netzbetriebs – mit steigender Abhängigkeit vom technischen und organisatorischen Zusammenspiel aller Marktteilnehmer.
Technische & organisatorische Prozesse des Redispatches
Der Redispatch-Prozess ist ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus Prognosen, Netzberechnungen, Steuerbefehlen und bilanzieller Abwicklung. Der gesamte Ablauf ist hochgradig datengetrieben und stützt sich auf standardisierte Kommunikationsprozesse zwischen Netzbetreibern, Direktvermarktern, Bilanzkreisverantwortlichen und Anlagenbetreibern.
1. Prognosephase
Am Anfang steht die Prognosephase. Hier liefern Anlagenbetreiber beziehungsweise ihre Direktvermarkter Vorhersagen zur erwarteten Stromeinspeisung. Bei erneuerbaren Energien erfolgt dies meist auf Basis meteorologischer Daten und entsprechender Wettermodelle. Parallel dazu erstellen die Netzbetreiber Verbrauchsprognosen für ihre Versorgungsgebiete. Beide Datenströme werden zusammengeführt, um eine möglichst präzise Gesamtvorhersage zu erhalten. Diese Prognosen sind entscheidend, denn jede Abweichung kann zu falschen Planungsannahmen und damit zu unnötigen Eingriffen oder im schlimmsten Fall zu einer Netzüberlastung führen.
2. Netzsicherheitsberechnung
Auf Grundlage dieser Vorhersagen führen die Netzbetreiber eine Netzsicherheitsberechnung durch. Dabei werden die zu erwartenden Stromflüsse für den kommenden Tag – und im Intraday-Betrieb sogar laufend – simuliert. In dieser Simulation werden sowohl die physikalischen Gegebenheiten der Netztopologie als auch mögliche Einschränkungen durch Wartungsarbeiten oder Netzstörungen berücksichtigt. Zeigt die Berechnung, dass bestimmte Leitungsabschnitte überlastet werden könnten, wird der Redispatch ausgelöst.
3. Planung
Die Planung sieht dann vor, welche Anlagen ihre Einspeisung reduzieren („Abregelung“) und welche sie erhöhen („Aufsteuerung“) sollen. Dabei spielen nicht nur die rein physikalischen Gegebenheiten eine Rolle, sondern auch wirtschaftliche Kriterien. So werden oft diejenigen Erzeuger als Erstes eingesetzt, deren Anpassung die geringsten Kosten verursacht oder deren Einfluss auf den Marktpreis minimal ist. Im Idealfall geschieht dies automatisiert über Optimierungsalgorithmen, die verschiedene Maßnahmenvorschläge gegeneinander abwägen.
4. Abrufphase
Sobald die Planungen abgeschlossen sind, beginnt die Abrufphase. Über Fernwirktechnik – beispielsweise Funk-Rundsteuerempfänger, IP-basierte Steuerboxen oder direkte SCADA-Anbindungen – werden die entsprechenden Signale an die Anlagen übermittelt. Je nach Dringlichkeit erfolgt der Abruf für den Folgetag oder im laufenden Betrieb mit sehr kurzen Reaktionszeiten. Die technische Zuverlässigkeit dieser Kommunikation ist ein kritischer Erfolgsfaktor, da eine verspätete oder nicht umgesetzte Maßnahme den Engpass unvermindert bestehen lassen würde.
5. Bilanzierung
Nach der Umsetzung folgt die bilanzielle Abwicklung. Hier werden die durch den Redispatch verursachten Abweichungen von den ursprünglichen Fahrplänen ermittelt und zwischen den beteiligten Marktakteuren ausgeglichen. Für Anlagenbetreiber bedeutet dies in der Regel eine Entschädigungszahlung, deren Höhe sich an den entgangenen Erlösen orientiert. Die bilanzielle Abwicklung ist komplex, da sie sowohl die physikalischen als auch die wirtschaftlichen Folgen des Eingriffs berücksichtigt und in vielen Fällen mehrere Netz- und Marktrollen betrifft.
Redispatch ist damit weit mehr als ein einfacher Steuerbefehl – er ist ein durchgängig vernetzter Prozess, der Datenqualität, IT-Schnittstellen und Reaktionsgeschwindigkeit in den Mittelpunkt stellt. Ohne Automatisierung und standardisierte Abläufe wäre das heutige Maß an Eingriffen kaum mehr zu bewältigen.
Plattformen & IT-Infrastruktur für den Redispatch
Die Koordination von Redispatch-Maßnahmen wäre ohne spezialisierte IT-Plattformen und standardisierte Datenprozesse nicht denkbar. In Deutschland hat sich in den letzten Jahren ein Ökosystem aus zentralen, dezentralen und hybriden Lösungen etabliert. Diese arbeiten überwiegend cloudbasiert und stellen den Informationsaustausch zwischen allen beteiligten Netz- und Anlagenbetreibern sicher. Die verschiedenen Plattformen sind das technische Rückgrat des Engpassmanagements – sie bündeln Daten, berechnen Netzflüsse, optimieren Maßnahmen und übermitteln Steuerbefehle.
Datenkoordination & Modelle
Ein zentrales Merkmal ist die Unterscheidung zwischen zentralisierter und dezentraler Koordination. Bei der zentralisierten Variante fließen sämtliche netzrelevanten Daten – von Engpassmeldungen über Flexibilitätsangebote bis hin zu Preisinformationen – an eine gemeinsame Plattform, die netzebenenübergreifend die Maßnahmenplanung übernimmt. Beispiele dafür sind die Plattform DA/RE (DAta exchange/Redispatch) und die comax-Plattform aus dem Forschungsprojekt C/sells. Der Vorteil liegt in der einheitlichen Optimierung über alle Netzebenen hinweg, was besonders bei komplexen Engpasssituationen mit vielen Beteiligten Effizienzgewinne ermöglicht.
Die dezentrale Koordination setzt hingegen darauf, dass jeder Netzbetreiber die Netzsicherheitsberechnung für sein eigenes Gebiet durchführt und die Ergebnisse an die über- oder nachgelagerten Betreiber weitergibt. Dieser „Bottom-up“-Ansatz bietet den Vorteil, dass lokale Gegebenheiten genauer berücksichtigt werden können. Er ist jedoch stärker von der Qualität und Geschwindigkeit der Datenweitergabe abhängig und erfordert klar definierte Schnittstellen.
Schnittstellen
Ein besonders wichtiger Baustein sind daher standardisierte Schnittstellen und Formate. Über APIs und marktweit definierte Datenmodelle – etwa im Rahmen von Connect+ – wird sichergestellt, dass auch heterogene IT-Systeme miteinander kommunizieren können. Legacy-Systeme wie SAP-IS-U oder SIV werden häufig über Integrationsplattformen angebunden, um die bestehenden Prozesslandschaften der Netzbetreiber nicht komplett umstellen zu müssen. Auf diese Weise lässt sich die Redispatch-Kommunikation sowohl in klassische Netzleitsysteme als auch in moderne cloudbasierte Anwendungen einbinden
Automatisation & Sicherheit
Die Plattformen selbst bieten zunehmend automatisierte Funktionen: Prognose-Engines verarbeiten Wetter-, Last- und Erzeugungsdaten in Echtzeit, Optimierungsalgorithmen berechnen die effizientesten Engpassmaßnahmen, und Abrufe werden automatisch über die passenden Kommunikationskanäle ausgelöst. Auch die Abrechnungsprozesse lassen sich in vielen Fällen automatisieren, wodurch manuelle Arbeitsschritte und Fehlerpotenziale reduziert werden. Angesichts der systemkritischen Rolle dieser Plattformen gelten hohe Anforderungen an IT-Sicherheit, Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Viele Betreiber verfolgen das Prinzip „Resilience by Design“, bei dem Redundanz, Notfallpläne und Cybersecurity-Maßnahmen von Anfang an in die Systemarchitektur integriert sind. Zudem wird auf Interoperabilität geachtet, damit verschiedene Plattformen und Netzbetreiberprozesse miteinander harmonieren.
Kommunikation & Steuerung der Anlagen
Die eigentliche Umsetzung von Redispatch-Maßnahmen steht und fällt mit der technischen Möglichkeit, Anlagen sicher, schnell und präzise anzusteuern. In der Praxis bedeutet das, dass Erzeugungsanlagen, Speicher und in manchen Fällen auch steuerbare Verbraucher über geeignete Schnittstellen mit den Netz- oder Direktvermarktungssystemen verbunden sein müssen.
Von analoger zur digitalen Steuerung
Historisch wurden viele Anlagen über Funk-Rundsteuertechnik (FRT) eingebunden. Dieses Verfahren ist robust und vergleichsweise einfach, hat aber Einschränkungen in der Datenübertragungsrate und Flexibilität. Mit zunehmender Komplexität der Redispatch-Anforderungen – etwa häufigeren Abrufen, abgestuften Leistungsreduzierungen oder kurzfristigen Fahrplananpassungen – stoßen rein analoge Steuerwege an ihre Grenzen. Daher setzen immer mehr Betreiber auf digitale Steuerlösungen. Dabei sind die Anlagen IP-basiert via Mobilfunk oder Internet angebunden, so dass eine bidirektionale Kommunikation möglich wird. So ist es möglich, nicht nur Steuerbefehle, sondern auch Betriebsdaten und Rückmeldungen über den aktuellen Leistungszustand der Anlage zu übertragen.
Protokolle & Speicher
Die technische Umsetzung erfolgt meist über Fernwirktechnik oder Steuerboxen, die Standardprotokolle wie IEC 60870-5-104 oder IEC 61850 unterstützen. So lassen sich Abrufe nahtlos in Netzleit- und Vermarktungssysteme integrieren. Speicheranlagen nehmen dabei eine Sonderrolle ein: Sie können Engpässe durch gezieltes Laden oder Entladen in beide Richtungen sekundengenau entschärfen. Dabei erfordert die Steuerung von Batteriegroßspeichern besonders präzise Planvorgaben, da ihre Lade- und Entladezyklen zeitlich begrenzt und wirtschaftlich optimiert sind.
Kommunikationslogik & Monitoring
Neben der Hardware spielt die Kommunikationslogik eine entscheidende Rolle. Die Abrufsignale folgen meist einer hierarchischen Struktur: Zunächst wird die Maßnahme über die zentrale oder dezentrale Redispatch-Plattform ermittelt, dann an den zuständigen Netzbetreiber oder Direktvermarkter übergeben und schließlich als Steuerbefehl an die Anlage gesendet. Dieser Ablauf muss so gestaltet sein, dass die Latenz minimal bleibt – insbesondere bei kurzfristigen Intraday-Anpassungen, die innerhalb von Minuten wirksam werden müssen. Dabei muss aus regulatorischen Gründen jeder Abruf nachvollziehbar sein. Das Monitoring, wann welche Anlage welchen Befehl erhalten und umgesetzt hat, erfordert eine lückenlose Datenerfassung auch zur späteren Bilanzierung oder Fehlerrecherche.
Herausforderungen & Potenziale beim Redispatch
Der Redispatch-Prozess steht vor mehreren Herausforderungen: Die Datenqualität und Verfügbarkeit sind oft unzureichend, besonders bei kleinen oder älteren Anlagen. Unterschiedliche IT-Systeme und fehlende einheitliche Schnittstellen erschweren die automatisierte Steuerung und erhöhen den manuellen Aufwand. Kurzfristige Engpässe erfordern schnelle Reaktionszeiten, die aktuell nicht immer gewährleistet sind. Zudem führen komplexe Abrechnungen und verzögerte Zahlungen zu Unzufriedenheit bei Anlagenbetreibern.
Gleichzeitig bieten sich große Chancen durch die Einführung einheitlicher Schnittstellen, cloudbasierte Plattformen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur besseren Prognose und Steuerung. Die Einbindung dezentraler Flexibilitäten wie Speicher und steuerbare Lasten kann helfen, Netzengpässe zu vermeiden und den Redispatch effizienter zu gestalten. Durch weitere technische, organisatorische und regulatorische Verbesserungen kann Redispatch künftig zuverlässiger, kosteneffizienter und nutzerfreundlicher werden.
Zukunft des Redispatch
Der Redispatch wird sich weiterentwickeln und an die Herausforderungen der Energiewende angepasst. Ein wesentlicher Treiber wird die verstärkte Digitalisierung und Automatisierung der Netzsteuerung sein. Dabei sorgen modernste Plattformen und neue Standrads für mehr Effizienz. Auch die Rolle dezentraler Energieanlagen und Flexibilitäten wächst weiter. Batteriespeicher, Elektromobilität und steuerbare Lasten werden verstärkt in das Redispatch integriert, um Netzengpässe frühzeitig abzufedern und den Netzausbau zu entlasten. Virtuelle Kraftwerke und Aggregatoren werden dabei eine Schlüsselrolle spielen, indem sie viele kleine Anlagen bündeln und koordinieren.
Darüber hinaus wird die stärkere Einbindung von Künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Algorithmen die Prognosegenauigkeit und Steuerungsqualität verbessern. Allerdings sind auch regulatorische Anpassungen notwendig. Um Transparenz, Fairness und Akzeptanz zu fördern, sollte die Harmonisierung von Abrechnungsprozessen und die Einführung automatisierter Bilanzausgleiche vorangetrieben werden.
Fazit
Der Redispatch ist ein unverzichtbares Instrument, um Netzengpässe zu vermeiden und die Stabilität der Stromversorgung in Deutschland sicherzustellen – besonders im Zuge der Energiewende und dem zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien. Mit der Weiterentwicklung zu Redispatch 2.0 wurde der Kreis der beteiligten Anlagen deutlich erweitert, was jedoch neue technische und organisatorische Herausforderungen mit sich bringt.
Die Zukunft des Redispatch liegt in der stärkeren Digitalisierung, Automatisierung und Integration dezentraler Flexibilitäten. Moderne IT-Plattformen, standardisierte Schnittstellen und intelligente Steuerungssysteme werden den Prozess effizienter und transparenter machen. Gleichzeitig sind regulatorische Anpassungen notwendig, um die Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit für alle Beteiligten zu verbessern.