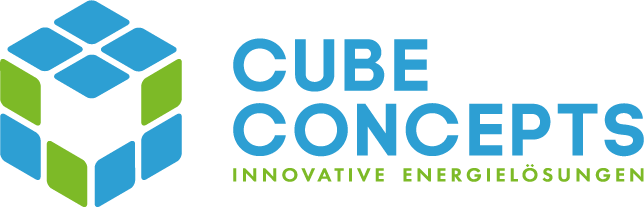Das Redispatch-Verfahren galt ursprünglich nur für Stromerzeuger bzw. Photovoltaikanlagen-Betreiber mit einer Leistung ab 10 MWp, wurde im Oktober 2021 zum sog. Redispatch 2.0 erweitert und gilt seitdem für alle Anlagen ab einer Größe von 100 kWp. Es ist ein Verfahren zur Steuerung und Koordination von Stromnetzen. Es soll sicherstellen, dass die Einspeisung und Abnahme von Strom im Netz jederzeit im Gleichgewicht sind. Das Redispatch 2.0 soll Stromausfälle vermeiden und gilt für alle Kraftwerkbetreiber. Der Einsatz aller Kraftwerke wird nämlich regional, zeitlich und stufenweise im sog. bundesdeutschen Dispatch – einer Art Fahrplan – von Tag zu Tag neu geplant. Das Redispatch 2.0 greift nur dann ein, wenn aufgrund von Engpässen im Stromnetz die Leitungen überlastet sind. In diesem Fall können Netzbetreiber bestimmte Erzeugungs- oder Verbrauchseinheiten auffordern, ihre Stromproduktion oder ihren Stromverbrauch zu ändern, um die Überlastung des Netzes zu reduzieren. Die betroffenen Betreiber der Anlagen erhalten dafür eine Entschädigung. Diese kommen sie entweder von den Netzbetreibern direkt oder über Umwege von den jeweiligen Direktvermarktern.
Ziel des Redispatch 2.0 Verfahrens: Schnellerer Ausbau der Energieleitungen

Das Redispatch 2.0 Verfahren ist Teil des Gesetzes zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus (EnLAG). Es soll dazu beitragen, den Ausbau der Stromnetze zu beschleunigen und damit die Energiewende in Deutschland zu unterstützen. Die deutschen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNBs) nutzen den Mechanismus. Er bezieht sich auf die Verordnung über Maßnahmen zur Netz- und Systemsicherheit im Elektrizitätsnetz (Maßnahmenverordnung Strom 2020 – MaßnVStrom 2020) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Es sieht vor, dass die ÜNBs bestimmte Anlagen im Netz bei Bedarf zur Einspeisung oder Reduzierung von Strom verpflichten können. Diese Anlagen werden als Redispatch-Anlagen bezeichnet.
Verbrauch & Erzeugung effektiv planen und lenken

Konkret bedeutet dies, dass die ÜNBs den Einsatz aller Stromerzeuger anhand von Verbrauchs- und Erzeuger-Prognosen von Tag zu Tag planen. Damit soll eine stabile Stromversorgung aller Regionen in Deutschland ermöglicht werden. Sie können das Redispatch 2.0 Verfahren einleiten, wenn das Stromnetz beispielsweise durch eine defekte Stromleitung, einen kompletten Ausfall einer Stromerzeugungsanlage oder durch Schwankungen der volatilen Energiequellen, wie Windkraft und Solarenergie, beeinträchtigt wird. In diesem Fällen können die ÜNBs bestimmte Redispatch-Anlagen aktivieren, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten oder deaktivieren um das Stromnetz zu entlasten. Die Kosten für die Redispatch-Maßnahmen werden auf die Betreiber der Redispatch-Anlagen umgelegt. Wenn beispielsweise die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen höher ist als der Strombedarf, hilft das Redispatch 2.0 Verfahren. Der Überschuss an Strom wird in diesem Falle entweder in das Netz integriert oder die Stromerzeugung aus anderen Quellen reduziert.

Technische Voraussetzungen zur Teilnahme am Redispatch 2.0
Technisch werden PV-Anlagen ab 100 kWp über eine Schnittstelle an einen leicht zu installierenden Funk-Rundsteuerempfänger angeschlossen und mit dem Redispatch-Verfahren verbunden. Das Gerät empfängt über ein Funksignal von einem zentralen Steuerungssystem Befehle, die die Leistung der Erzeugungsanlage erhöhen oder verringern können. Die Datengrundlage bilden dabei die Werte, die durch ein Smart Meter ständig übermittelt werden. Man verbaut beide Geräte in der Regel auch in den Dach-Photovoltaikanlagen, bei Solarparks und Solar-Carpots. Sie lassen sich ggf. bei Bestandsanlagen nachrüsten.
Weiterverarbeitung der gesammelten Daten
Alle Daten sämtlicher Kraftwerke laufen beim Übertragungsnetzbetreiber ein, der täglich eine neue Netzbelastungsberechnung durchführt, um kurzfristige Redispatches möglichst zu gering zu halten. Deren Arbeit hat sich mit der Ausweitung des Redispatches 2.0 naturgemäß erheblich erhöht. Dabei sind auch die Kosten der Maßnahmen erheblich gestiegen. Diese lagen in Gesamtdeutschland mit 612 Millionen Euro bereits im Jahre 2021 auf einem Rekordniveau. Ein Grund dafür war wohl auch auf die Entwicklung neuer Bilanzierungs-, Abrechnungs- und Abrufungsmodelle.
Kritik am Redispatch 2.0

Der ganze Redispatch 2.0 Prozess zwischen Anlagenbetreibern, Direktvermarktern und Netzbetreibern ist seit seiner Einführung im Oktober 2021 noch nicht final geregelt. Bisher wird koordinieren beispielsweise die Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) den finanzielle Ausgleich der Netzbetreiber. Einen automatischen Bilanzausgleich gibt es noch nicht. Dies ist auf fehlende Daten- und Schnittstellenstandrads zurückzuführen und verursacht zusätzliche Kosten, da der BKV die Strommengen manuell zu- oder verkaufen muss. Dieser Bottleneck sorgt auch dafür, dass Anlagenbetreiber länger auf ihre Vergütung warten müssen und sich in den Abrechnungen Fehler einschleichen.
Gerade Photovoltaik-Anlagenbetreiber können in der Regel keine eindeutige Prognose über den in Zukunft erzeugten Strom abgeben und somit nur sehr schlecht die Einspeise- oder Zukaufmenge im Voraus planen. Daher werden jedes Mal bei Redispatch-Eingriffen immer noch individuelle Abrechnungen erstellt. Dieser riesige Mehraufwand sorgt nicht nur bei den BKVs sondern auch bei den Direktvermarktern zunehmend auf Unverständnis. Sie können nämlich die Vergütung an die Anlagenbetreiber ebenfalls nur verzögert mit einem Mischpreis auszahlen, der im Zweifel unterhalb des Marktwertes liegt.
Der Netzausbau muss dringend vorangetrieben werden. Der Redispatch 2.0 kann diesen Prozess nur beschleunigen, wenn er selbst klar geregelt ist und damit die aktuelle aufwendige Zwischenlösung ersetzt wird.