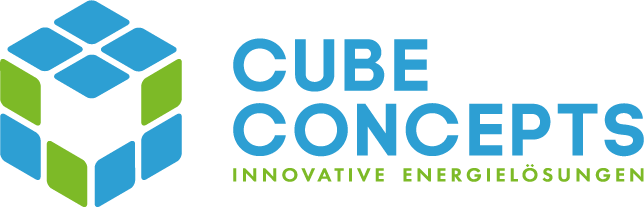Die Energiewende verändert die Struktur der Stromnetze grundlegend. Mit dem Ausbau erneuerbarer Erzeugung, dem Hochlauf der Elektromobilität und der Elektrifizierung industrieller Prozesse steigt die Zahl flexibler, zugleich aber auch volatiler Stromflüsse im Netz. Immer häufiger entstehen lokale Überlastungen oder ungenutzte Kapazitäten – je nach Tageszeit und Einspeisesituation. Daher ist Flexibilität (z. B. Lastverschiebung, Lastsenkung in kritischen Zeiten) zur Entlastung der Netze jetzt der neue Goldstandrad, um die Kosten für den notwendigen Netzbetrieb und Ausbau möglichst gering zu halten. Dies ist dringend notwendig da heute schon 1/3 des Gesamtstrompreises aus Netzentgelten besteht.
Um Schwankungen besser zu steuern, rückten dynamische Netzentgelte zunehmend in den Fokus der Regulierung. Denn bisher zahlten Verbraucher – unabhängig von der tatsächlichen Netzsituation – ein weitgehend fixes Entgelt pro Kilowattstunde. Damit fehlte der ökonomische Anreiz, Lasten gezielt in netzentlastende Zeiten zu verschieben.
Seit 2025: Nur “zeitvariable Netzentgelte”
Seit dem 1. April 2025 gilt eine gesetzliche Verpflichtung für alle Verteilnetzbetreiber (VNB) in Kraft, zeitvariable Netzentgelte anzubieten. Grundlage ist die Reform des § 14a des EnWG (Energiewirtschaftsgesetzes), der im Zuge der Energiewende angepasst wurde, um steuerbare Verbrauchseinrichtungen besser einbinden zu können.
Etwa zeitgleich startete die Bundesnetzagentur mit der Arbeitsgemeinschaft Netzentgeltsystematik (AgNeS), die einen komplett neuen Rahmen für die Netzentgeltsystematik für Deutschland bis spätestens Ende 2028 erarbeiten soll. Die neue StromNEV (Stromnetzentgeltverordnung) wird künftig das Verhalten von Verbrauchern und Betreibern steuerbarer Anlagen gezielt in Richtung Netzstabilität lenken. Vorgesehen sind Preissignale, die sich an der aktuellen oder prognostizierten Auslastung des Netzes orientieren.
Für Industrie- und Gewerbebetriebe eröffnet sich damit ein neues Steuerungsinstrument: Wer Lasten flexibel verschieben kann, profitiert von reduzierten Netzentgelten und trägt zugleich zur Entlastung der Infrastruktur bei.
Was sind dynamische Netzentgelte?
Dynamische Netzentgelte sind ein Instrument, um die Nutzung der Stromnetze besser an die tatsächliche Belastung anzupassen. Anders als bei herkömmlichen Netzentgelten, die unabhängig von Ort und Zeit berechnet werden, verändern sich dynamische Entgelte ständig und in Echtzeit abhängig von der Netzsituation – also davon, wie stark ein Netzabschnitt gerade ausgelastet ist oder voraussichtlich ausgelastet sein wird.
Ziel ist es, Preissignale für netzdienliches Verhalten zu schaffen. In Zeiten hoher Netzlast steigen die Entgelte, in schwach ausgelasteten Stunden sinken sie. Dadurch sollen Verbraucher, Unternehmen und steuerbare Anlagen wie Wärmepumpen, Speicher oder Ladeinfrastruktur motiviert werden, ihren Stromverbrauch flexibel zu verschieben.
Abgrenzung zu bisherigen Modellen
Seit April 2025 bieten viele der etwa 800-850 deutschen Verteilnetzbetreiber sogenannte Time-variable grid charges an – meist in Form eines dreistufigen Modells. Diese Zeitfenster werden im Voraus definiert, gliedern sich nach Tageszeiten oder Quartalen und teilen die Tarife in der Regel in Niedriglast- (NT), Standard- (ST) and Hochlastzeiten (HAT) auf.Dynamische Netzentgelte gehen allerdings einen Schritt weiter:
- Sie können stündlich or sogar viertelstündlich variieren, abhängig von der tatsächlichen Netzbelastung.
- Sie basieren auf Echtzeitdaten oder Netzlastprognosen.
- Sie ermöglichen eine regionale Differenzierung, etwa auf Ebene einzelner Netzgebiete.
Damit entsteht ein System, das ähnlich wie dynamic electricity tariffs funktioniert – allerdings auf der Netzentgeltkomponente der Stromrechnung.
Nutzen & Zielsetzung
Durch diese differenzierte Preisgestaltung soll sich das Verhalten der Verbraucher stärker an der Netzstabilität orientieren. Wenn viele Teilnehmer auf Preissignale reagieren, lassen sich Lastspitzen abflachen und Investitionen in Netzausbau reduzieren. Für Unternehmen mit steuerbaren Prozessen bietet das die Chance, Netzentgelte gezielt zu optimieren – etwa durch den Einsatz von Energy management systems or Large battery storage systems.
Aktuelle & künftige Rechtsrahmen
Bislang konnten energieintensive Unternehmen über verschiedene Mechanismen reduzierte Netzentgelte erhalten, wenn ihr Lastverhalten zur Netzstabilität beitrug oder sich durchgängig gleichmäßig gestaltete. Die beiden wichtigsten Regelungen waren die Bandlastregelung and the Atypical grid usage gemäß § 19 StromNEV. Kurz erklärt:
- Belt load (§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV): Unternehmen mit einem konstanten Leistungsbezug über das Jahr hinweg – also einer nahezu gleichbleibenden Bandlast – konnten ein individuelles Netzentgelt beantragen. Diese Regelung honorierte eine gleichmäßige Netzbelastung ohne ausgeprägte Spitzen.
- Atypical grid usage (§ 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV): Hier profitierten Betriebe, die ihre Last gezielt außerhalb der Hochlastzeiten des regionalen Netzbetreibers verschoben. Die Hochlastzeitfenster wurden vom jeweiligen VNB definiert und lagen meist in den frühen Abendstunden oder während winterlicher Spitzenlasten. Durch die Verlagerung von Verbrauch in netzentlastende Zeiten konnten Unternehmen teils erhebliche Entgeltreduktionen erreichen.
Diese beiden Instrumente waren lange zentrale Elemente der Netzentgeltlogik im Industriebereich mit der sich die Netzentgelte bis zu 90% reduzieren ließen. Sie setzen jedoch auf statische Zeitfenster und Jahresbewertung, nicht auf kurzfristige Netzsignale. Mit der geplanten Reform der Netzentgeltsystematik – insbesondere dem Auslaufen der § 19-Sonderregelungen und der Einführung dynamischer Netzentgelte – wird dieser Mechanismus schrittweise durch ein flexibleres, datenbasiertes System ersetzt. Künftig sollen Preissignale in Echtzeit or auf Stundenbasis auf Netzengpässe reagieren, anstatt auf pauschal definierte Lastfenster.
Neue Rahmenmethodik für dynamische Netzentgelte durch AgNeS
Der erste Schritt in Richtung dynamische Netzentgelte bildet der nun reformierte § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), der seit April 2025 gültig ist. Im zweiten Schritt erarbeitet die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Netzentgeltsystematik (AgNeS) eine Reform of electricity grid charges, um die komplexen methodischen und regulatorischen Fragen zu klären. Sie erarbeitet Empfehlungen, wie ein zukünftiges, bundesweit vergleichbares System dynamischer Netzentgelte ausgestaltet werden kann. AgNeS entwickelt dabei Grundprinzipien and Bewertungsmechanismen, etwa:
- welche Datenbasis (z. B. Netzlastprognosen) genutzt werden darf,
- wie Lastverschiebungen zu bewerten sind,
- und wie regionale Unterschiede abgebildet werden können.
AgNeS legt jedoch keine konkreten Zeitfenster oder Tarife fest. Diese bleiben weiterhin in der Verantwortung der einzelnen Verteilnetzbetreiber, die ihre Modelle an die lokalen Netzgegebenheiten anpassen dürfen.
Aktuelle Situation: Übergangsphase zur Einführung dynamischer Netzentgelte
Demnach befindet sich das System für dynamische Netzentgelte derzeit in einer Übergangsphase. Während § 14a EnWG bereits die rechtliche Verpflichtung zur Einführung zeitvariabler Entgelte enthält, experimentieren viele VNBs mit unterschiedlichen Modellen – von festen Hochlastzeiten bis hin zu ersten dynamischen Ansätzen. Erst ab 2026/2027 ist geplant, dass auf Basis der AgNeS-Empfehlungen ein bundesweit harmonisiertes, aber regional anpassbares System eingeführt wird. Damit soll eine Balance entstehen zwischen einheitlicher Struktur (Transparenz, Vergleichbarkeit) und lokaler Flexibilität (Netzrealität, Lastprofile).
Wie gestalten VNB heute ihre Netzentgelte?
Neben fixen Netzentgelten pro kWh verpflichtet § 14a EnWG die Netzbetreiber erstmalig, mindestens ein zeitvariables Netzentgeltmodell anzubieten. Viele VNB haben sich dabei für ein 3-stufiges Modell entschieden und bieten nun NT-, ST- und HA-Zeitfenster an. Allerdings bleibt die konkrete Ausgestaltung ihnen überlassen. Hier der aktuelle Stand im Überblick:
| Gestaltungsspielraum | Jeder VNB kann selbst festlegen: – Wann NT/HT gelten (z. B. tageszeitlich oder quartalsweise) – Wie stark die Preisunterschiede sind (innerhalb gesetzlicher Grenzen) – Wie groß das Zeitfenster pro Stufe ist. |
| Zeitfenster-Beispiele | Viele VNB wählen nachts (0–5 Uhr) oder PV-Überschusszeiten (z. B. mittags) als NT. HT wird meist in Abendstunden (17–21 Uhr) oder bei Netzspitzen berechnet. Manche wenden NT/HT nur in Q1 and Q4 an, andere ganzjährig. |
| Ziel des Modells | Erproben, wie sich flexible Lasten auf die Netzstabilität auswirken. Einheitliche, bundesweite Zeitfenster wären kontraproduktiv, da Netzbelastung regional unterschiedlich ist. |
| Datenbasis | Manche Netzbetreiber koppeln die Zeitfenster bereits an Prognosen oder Echtzeit-Netzlasten, andere definieren sie vorab statisch (z. B. feste Uhrzeiten). |
| Industrie/Gewerbe | Für RLM-Kunden (mit Leistungsmessung) sind die Systeme bisher noch nicht flächendeckend verfügbar oder umgesetzt. Einzelanfragen an den VNB sind notwendig. |
Chancen für Industrie & Gewerbe: Vom Kostenfaktor zum Steuerungselement
Die Einführung dynamischer Netzentgelte stellt für Unternehmen nicht nur eine regulatorische Umstellung dar, sondern eröffnet vor allem erhebliche wirtschaftliche und strategische Potenziale. Insbesondere Betriebe mit steuerbaren Lasten (z. B. industrielle Produktionsanlagen, Kälteanlagen, Speicherlösungen, E-Flotten) können von der neuen Systematik profitieren, indem sie ihre Strombezugskosten aktiv managen.
Gezielte Kostenoptimierung durch Lastverschiebung
Die offensichtlichste Chance liegt in der direkten Reduzierung der Netzentgelte. Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs aus Hochlastzeiten (HT) in Niedriglastzeiten (NT) können Unternehmen ihre Netzentgelte minimieren. Load shifting zwischen NT- und HT-Tarifen führt dabei zum sofortigen Einsparpotenzial.
Synergien mit Energiemanagementsystemen (EMS) und Speichern
Dynamische Netzentgelte verstärken den Nutzen von bereits installierten oder geplanten Energiemanagementsystemen (EMS). Ein intelligentes EMS senkt nicht nur die direkten Stromkosten (durch dynamische Stromtarife), sondern auch die Netzentgelte lassen sich nun automatisiert in die Steuerung von Prozessen einbeziehen. Das EMS wird zur zentralen Schaltstelle für die netzdienliche Lastverschiebung. Zusätzlich steigt die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern. Sie können in NT-Zeiten oder bei geringer Netzauslastung geladen und in HT-Zeiten oder bei lokaler Überlastung zur Eigennutzung entladen werden. Dies optimiert nicht nur den Stromeinkauf, sondern auch die Netznutzungskosten.
Vorbereitung auf künftige Energiemärkte
Die Anpassung an dynamische Netzentgelte ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung and Flexibilization der Energieinfrastruktur von Unternehmen. Sie schafft die Grundlage für die künftige Teilnahme an weiteren Flexibilitätsmärkten (z. B. Control energy-Märkte) und der Vernetzung als aktiver Teil des Energiesystems (Stichwort: Sektorenkopplung und virtuelle Kraftwerke). Unternehmen werden damit von passiven Stromabnehmern zu aktiven Gestaltern des Netzbetriebs.
Herausforderungen & Offene Fragen
Trotz der klaren Vorteile und der regulatorischen Notwendigkeit sind der Einführung und dem Erfolg dynamischer Netzentgelte noch einige wesentliche Herausforderungen und offene Fragen verbunden, die von Gesetzgeber, BNetzA, VNBs und Unternehmen gleichermaßen adressiert werden müssen.
Regulatorische und technische Komplexität
Die Umstellung auf ein neues System bringt sowohl regulatorische als auch technische Hürden mit sich:
- Harmonisierung und Vergleichbarkeit: Obwohl die AgNeS einen bundesweiten Rahmen schaffen soll, bleibt die finale Gestaltung bei den über 800 Verteilnetzbetreibern. Für bundesweit agierende Unternehmen oder große Industriekunden kann dies einen Flickenteppich unterschiedlicher Entgeltmodelle bedeuten, was die zentrale Steuerung und Prognosen erschweren.
- Dateninfrastruktur und -verfügbarkeit: Die wirklich dynamischen Netzentgelte erfordern eine zuverlässige, kurzfristige Bereitstellung von Netzlastdaten oder Prognosen in Echtzeit (viertelstündlich oder stündlich). Die flächendeckende Ausrollung intelligenter Messsysteme und die Schaffung der notwendigen Datenplattformen sind die technischen Grundvoraussetzungen, die noch nicht überall gegeben sind.
- Übergang für RLM-Kunden (Industrie): Für Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM) – also die meisten Industrie- und Großgewerbekunden – ist die endgültige Methodik für dynamische Netzentgelte noch in der Entwicklung (BNetzA-Pläne ab 2026/2027). Die zeitliche Überlappung mit dem geplanten Auslaufen des § 19 StromNEV-Regelungen sorgt für Unsicherheit.
Integration in Unternehmensprozesse
Die erforderliche Flexibilität kollidiert in vielen Betrieben mit etablierten Produktions- und Geschäftsmodellen. Nicht alle Prozesse in Industrie und Gewerbe lassen sich ohne Weiteres in netzentlastende Zeiten verschieben. Gerade bei just-in-time-Produktion oder durchgängig notwendigen Betriebsprozessen müssen Unternehmen abwägen, inwieweit die Einsparungen bei den Netzentgelten die potenziellen Kosten durch Prozessunterbrechungen oder -verzögerungen aufwiegen. Zusätzlich erfordert die Nutzung dynamischer Entgelte oft Investitionen in modernere Anlagen, Speicher, Ladeinfrastruktur oder die Nachrüstung von EMS-Systemen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Investitionen muss im Einzelfall kritisch geprüft werden, sofern keine Contracting-Modelle verfügbar sind.
Akzeptanz & Kommunikation
Für Endkunden, kleine Gewerbebetriebe oder KMU ist das neue System deutlich komplexer als das bisherige fixe Entgelt. Transparenz und eine verständliche Kommunikation der neuen Tarife durch die VNBs sind entscheidend, um eine breite Akzeptanz und damit die notwendige Steuerungswirkung zu erzielen.
Ausblick: Dynamische Netzentgelte als zentraler Baustein des Energiesystems
Dynamische Netzentgelte sind nicht nur ein neues Abrechnungsinstrument, sondern ein zentraler Baustein für das zukünftige, flexible Energiesystem in Deutschland. Spätestens bis 2029 wird der regulatorische Rahmen eindeutig definiert sein.
Von statischen Zeitfenstern zur Echtzeit-Steuerung
Die aktuelle Übergangsphase mit ihren meist 3-stufigen, vorab definierten Zeitfenstern (NT, ST, HT) wird voraussichtlich nur ein Zwischenschritt sein. Die Empfehlungen der AgNeS und die spätere StromNEV-Reform werden das System in Richtung echter, datenbasierter Dynamik lenken. Das bedeutet, dass die Preissignale immer kurzfristiger und sollen stundenscharf oder viertelstundenscharf auf die tatsächliche oder prognostizierte Netzlast reagieren. Zudem werden die Netzentgelte künftig stärker die lokale Netzsituation widerspiegeln. Ein Unternehmen in einem Ballungsgebiet mit hoher Netzlast wird andere Signale erhalten als ein Betrieb in einem ländlichen, überschussreichen EE-Gebiet.
Künstliche Intelligenz als Beschleuniger
Die Komplexität von Echtzeit-Preissignalen aus Netzbelastung und Börsenstrompreis sowie die Notwendigkeit, Produktionspläne damit in Einklang zu bringen, wird ohne Künstliche Intelligenz and Advanced Analytics kaum zu managen sein. KI-basierte EMS-Systeme werden unverzichtbar, um die Vorhersage der Lastverschiebung unter Berücksichtigung von Strompreisen, Netzentgelten und Produktionsanforderungen zu optimieren. Dabei übernimmt sie die automatische Verschiebung steuerbarer Lasten, ohne manuelle Eingriffe oder eine Gefährdung der Betriebssicherheit.
Integration in das Gesamtsystem
Langfristig werden dynamische Netzentgelte mit den dynamischen Stromtarifen (Arbeitspreis) und den sich entwickelnden Flexibilitätsmärkten zu einem ganzheitlichen ökonomischen Rahmenwerk verschmelzen. Ziel ist ein Energiesystem, in dem jeder Akteur – von der Wärmepumpe im Haushalt bis zur Industrieanlage – über finanzielle Anreize zur Stabilisierung des Netzes beiträgt und die Kosten für den Netzausbau minimiert werden.
Für Unternehmen bedeutet dies: Wer sich jetzt mit der notwendigen Dateninfrastruktur, den geeigneten Energiemanagementsystemen und der Flexibilisierung seiner Prozesse aufstellt, wird nicht nur von den aktuellen Einsparungen profitieren, sondern ist optimal für das Energiesystem von morgen positioniert.