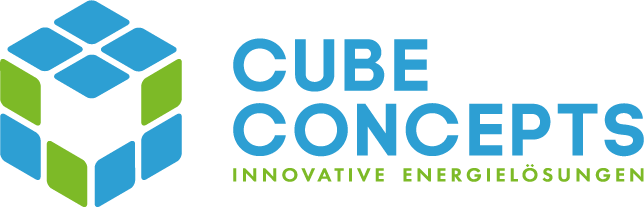Eine heiße Diskussion unter Energieexperten zeichnet sich nach der Veröffentlichung des Monitoringberichtes durch Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche ab. Thema: Das künftige Strommarktdesign. Der bisher in Deutschland vorherrschende Energy-Only-Markt (EOM) soll sich wandeln. Dabei erfolgt die Preisbildung im Großhandelsmarkt durch das Merit-Order-Prinzip. Die günstigsten Kraftwerke (meist EE-Kraftwerke) werden zuerst eingesetzt und den Marktpreis bestimmt das teuerste geforderte Kraftwerk. Dieses Modell ist in den meisten EU-Ländern vorherrschend, obwohl es bei der Integration der zunehmenden Anzahl von EE-Kraftwerken an seine Grenzen stößt.
Bis zu 435 Milliarden Euro Mehrbelastung
Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, plant das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) nun mit zusätzlichen Gaskraftwerken. Diese sollen durch neue Kapazitätsmechanismen am Strommarkt finanziert werden. Ein zentraler Marché de capacité mit einem Aufschlag von gerade einmal 2 Cent/kWh für den Endverbraucher solle hierzu bereits ausreichen, so die Bundeswirtschaftsministerin. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) schlägt jedoch jetzt Alarm. Er rechnet mit einer Mehrbelastung de bis zu 435 Milliarden Euro über 20 Jahre für Verbraucher und Industrie und warnt vor Fehlanreizen. Eine bessere Alternative sei die sog. Absicherungspflicht.
Welches Strommarktdesign eignet sich für Deutschland?
Die hohen Kosten für einen zentralen Kapazitätsmarkt, die nun im Raum stehen, befeuern den aktuellen Diskurs zum künftigen Strommarktdesign noch zusätzlich. Dabei liegen die verschiedenen Alternativmodelle zu einem EOM schon lange vor und werden bereits seit längerer Zeit in Fachkreisen diskutiert. Wie so oft, scheint eine Kombination aus Absicherungspflicht und Kapazitätsmarkt mit intelligenten Maßnahmen die Lösung für ein künftiges Strommarktdesign Deutschlands zu sein. Grund genug, um die Ansätze mit ihren Vor- und Nachteilen einmal genauer zu betrachten.
Reservenbildung als Schlüssel zur Energiewende
Sowohl die Absicherungspflicht sowie ein Kapazitätsmarkt sollen die volatile Stromerzeugung der EE-Quellen abfedern und die Stromversorgung während einer Période sombre sichern. Dabei unterscheidet sich bereits die Definition dieser Reserve in beiden Strommarktdesigns.
Une Kapazitätsreserve (KapRes), wie sie das Kapazitätsmarktmodell vorsieht, ist eine vom Strommarkt getrennte strategische Reserve. Sie soll die Stromversorgung in sehr seltenen, außergewöhnlichen und nicht vorhersehbaren Situationen sichern, wenn der normale Strommarkt die Nachfrage nicht decken kann. Kraftwerke in dieser Reserve werden außerhalb des Energiemarktes vorgehalten und kommen nur in definierten Ausnahmesituationen zum Einsatz, die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) festgelegt werden. Sie erhalten eine jährliche Vergütung für die reine Vorhaltung der Kapazität.
Le site Versorgungssicherheitsreserve (VSR) gemäß dem Absicherungspflicht-Modell ist aktiver Marktteilnehmer. Im Gegensatz zu einem zentralen Kapazitätsmarkt soll sie den Strommarkt weniger verzerren und Investitionen in Flexibilitätstechnologien (wie Accumulateur de grande capacité oder Lastmanagement/flexible Nachfrage) stärker fördern. Dazu wird die Reserve nur bei hohen Strommarktpreisen aktiviert und glättet auf diese Weise die Preisspitzen. Sie ist schneller und flexibler und deckelt die Preise weniger stark.
Kapazitätsmarkt-Elemente im Strommarktdesign
In Kapazitätsmärkten erhalten Betreiber von Kraftwerken oder Speichern nicht nur eine Vergütung für den tatsächlich erzeugten Strom, sondern zusätzlich eine Zahlung für die bloße Bereitstellung gesicherter Leistung. Ziel ist es, Investitionen in Reservekapazitäten zu ermöglichen und Engpässe im Stromnetz zu vermeiden. Je nach Ausgestaltung kann ein Kapazitätsmarkt zentral ou dezentral organisiert sein. In einem zentralen Modell – wie es aktuell diskutiert wird – schreibt eine zentrale Behörde regelmäßig benötigte Kapazitäten aus. Betreiber bieten ihre Leistungen an und der Zuschlag erfolgt nach Kosten.
Kritiker sehen darin jedoch erhebliche Nachteile. Zum einen drohen Fehlanreize, wenn auch unrentable ou klimaschädliche Anlagen künstlich am Markt gehalten werden. Zum anderen entsteht durch die zusätzlichen Kapazitätszahlungen ein erheblicher Kostenblock, der über Netzentgelte oder Strompreise auf alle Verbraucher und die Industrie umgelegt wird. Mehrere Studien zeigen, dass dies – je nach Modell – zu erheblichen Mehrbelastungen führen kann.
Befürworter argumentieren hingegen, dass nur ein expliziter Kapazitätsmechanismus langfristig Versorgungssicherheit garantiert, insbesondere wenn ältere Kraftwerke stillgelegt und wetterabhängige Energien weiter ausgebaut werden. Internationale Beispiele – etwa aus Frankreich oder Großbritannien – zeigen, dass Kapazitätsmärkte Versorgungslücken vorbeugen können, allerdings um den Preis einer höheren Marktkomplexität et administrativen Steuerung.
Die Absicherungspflicht als Alternative
Das Grundprinzip dieses Strommarktdesigns lautet: Wer Strom anbietet, muss sicherstellen, dass dieser auch dann verfügbar ist, wenn Sonne und Wind nicht ausreichen. Anbieter müssen also garantieren, dass jedem gelieferten MWh rechnerisch bereits eine tatsächliche Erzeugungskapazität mit einem festen Vertrag zugeordnet ist – und zwar weit im Voraus und für jede Viertelstunde des Jahres, bevor sie Strom überhaupt handeln können. Der Anreiz zur Beschaffung von gesicherter Leistung entsteht somit dezentral par la Marktteilnehmer selbst – nicht durch staatliche Ausschreibungen. Fehlende Absicherung oder Nichterfüllung der Verpflichtungen würde mit Ausgleichszahlungen oder Sanktionen belegt, was die Akteure zu einer realistischen Bewertung ihrer Versorgungssicherheit zwingt.
Viele Experten bevorzugen die Aspekte, die eine Absicherungspflicht mit sich bringt. Sie sehen darin einen effizienteren Weg, Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ohne hohe Fixkosten für Reservekapazitäten bleibt der Concours zwischen unterschiedlichen Technologien bestehen – von flexiblen Gaskraftwerken über Batteriegroßspeicher bis hin zu Lastmanagement-Systemen in der Industrie. Dies fördert gezielte, effiziente und innovative Investitionen ohne planwirtschaftliche Mengen- oder Technologievorgaben.
Gleichzeitig belohnt die Absicherungspflicht Flexibilité und belebt den Markt für Énergie de réglage. Speicherbetreiber, Anbieter von Demand-Side-Management oder Betreiber regelbarer KWK-Anlagen können ihre Kapazitäten an Energieversorger veräußern, die ihren Verpflichtungen nachkommen müssen.
Insgesamt ist der Bürokratieaufwand überschaubar, es entstehen keine fixen Kosten und Innovationen werden gefördert. Etwaige Subventionen, die gegen das EU-Recht verstoßen könnten, werden zudem umgangen. Im Gegenteil: Die Absicherungspflicht („Hedging Obligation“) ist in der aktuellen Strombinnenmarktrichtlinie der EU (Art. 18a, 2024) als Pflicht für die Mitgliedstaaten angelegt und muss bis spätestens 2027 konkret umgesetzt werden.
Hybride Ansätze und mögliche Kombinationen
In der aktuellen Diskussion zum Strommarktdesign zeigt sich zunehmend, dass Kapazitätsmarkt-Elemente in Deutschland zu hohen Kosten und geringer Markttransparenz führen werden. Daher gewinnen hybride Modelle an Bedeutung. Sie kombinieren Elemente beider Ansätze, um Versorgungssicherheit, Kosteneffizienz und Klimaziele in Einklang zu bringen.
Gezielte regionale Kapazitätsmechanismen für Gebiete mit Netzengpässen könnten neue Gaskraftwerke, Speicher oder flexible Verbraucher dort fördern, wo sie systemisch am meisten bewirken. Auch zeitlich begrenzte Kapazitätsauktionen – etwa zur Überbrückung von Phasen mit geringer Versorgungssicherheit – sind als Übergangslösung durchaus denkbar. Elemente der Absicherungspflicht sind aber in einem zukunftsfähigen Strommarktdesign unverzichtbar.
Entscheidend für den Erfolg eines hybriden Modells ist die Einbindung von Flexibilitätsoptionen. Moderne Batteriespeicher, Wärmespeicher und flexible industrielle Lasten können kurzfristig auf Marktpreise reagieren und Systemdienlichkeit erbringen. Werden sie in Absicherungspflicht berücksichtigt, sinkt der Bedarf an teuren Reservekraftwerken erheblich.
Damit rückt auch die Rolle der Industrie stärker in den Fokus: Unternehmen, die über steuerbare Lasten, Speicher oder Eigenstromerzeugung verfügen, könnten künftig nicht nur Stromverbraucher, sondern auch Anbieter von Versorgungssicherheit werden. Das Strommarktdesign der Zukunft muss diese Potenziale berücksichtigen und marktorientierte Rahmenbedingungen schaffen, die Innovation und Wettbewerb fördern – statt sie durch starre Strukturen zu bremsen.
Auswirkungen des Strommarktdesigns auf Industrie & Energieprojekte
Die Diskussionen zum künftigen Strommarktdesign bleibt nicht auf politischer oder systemischer Ebene stehen – sie betrifft unmittelbar die Industrie, Energieversorger und Projektentwickler. Für Unternehmen, die bisher nicht in Eigenversorgung oder Speicherlösungen investieren, wird die Ausgestaltung des künftigen Strommarktdesigns erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen haben.
Ein zentraler Kapazitätsmarkt, wie von Katharina Reiche vorgeschlagen, erhöht die Strompreise pauschal für alle Verbraucher. Gerade für energieintensive Betriebe bedeutet das steigende Beschaffungskosten und damit sinkende Wettbewerbsfähigkeit. Genau dies sollte eigentlich vermieden werden. Unternehmen mit eigener gesicherter Leistung – etwa durch KWK-Anlagen oder Speichern – können diesem Szenario gelassener entgegen schauen.
Im Gegensatz dazu entstehen bei einer Absicherungspflicht neue Rollen und Chancen für Marktteilnehmer, die bisher kaum erschlossen sind. Unternehmen, die bereits flexible Anlagen oder Speichersysteme nutzen, können aktiv am Stromhandel teilnehmen, Regelenergie vermarkten oder netzdienliche Dienste anbieten. Der Marktmechanismus belohnt dabei Innovationen und neue Technologien gleichermaßen.
Für Projektentwickler und Investoren ergeben sich neue Anforderungen an die Planung: Künftig dürfte die Bewertung von Projekten nicht mehr allein auf die Stromproduktion, sondern auch auf den Beitrag zur Versorgungssicherheit abzielen. Anlagen, die flexibel, steuerbar und netzdienlich agieren können, gewinnen an Wert.
Fazit – Die Weichen für das Strommarktdesign müssen jetzt gestellt werden
Die Debatte um das künftige Strommarktdesign zeigt, dass es keine einfache Antwort auf die Frage nach Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz gibt. Während zentrale Kapazitätsmärkte auf planbare Reservekraftwerke setzen, drohen hohe Fixkosten, Fehlanreize und steigende Strompreise. Die Absicherungspflicht hingegen fördert marktorientierte Investitionen in Flexibilitätstechnologien, vermeidet unnötige Bürokratie und ist bereits europarechtlich verankert. Hybride Modelle bieten die Chance, beide Ansätze gezielt zu kombinieren und regionale sowie technologische Besonderheiten zu berücksichtigen. Entscheidend wird sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovation, Wettbewerb und Systemstabilität gleichermaßen stärken – denn nur so kann Deutschland ein zukunftsfähiges, klimafreundliches und bezahlbares Strommarktdesign etablieren.