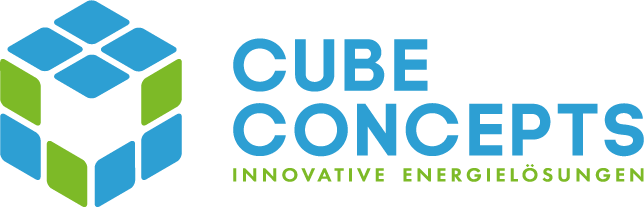Nicht ganz! Der von der deutschen Regierungskoalition geplante Industriestrompreis ab 2026 para 5 ct/kWh bezieht sich nämlich auf den Arbeitspreis. Grund genug, die Auswirkungen und geplanten Rahmenbedingungen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Weshalb ein Industriestrompreis ab 2026 eingeführt wird
Die Energiepreise sind für die deutsche Industrie seit Jahren ein strategisches Risiko. Obwohl sich die Großhandelspreise nach dem Energiepreisschock von 2022 wieder stabilisiert haben, lag der durchschnittliche Industriestrompreis in 2024 mit 23,3 ct/kWh und in 2025 mit 17,8 bis 18,8 ct/kWh weiterhin auf oberem EU-Niveau. Große energieintensive Unternehmen mit besonderen Vergünstigungen zahlen mit 11 bis 12 ct/kWh oft deutlich weniger.
Besonders relevant ist die Struktur dieser Kosten. Nur etwa 40 % entfallen auf den eigentlichen Arbeitspreis, also den Strom, der physikalisch verbraucht wird. Dieser liegt derzeit bei rund 9 ct/kWh. Die restlichen 60 % bestehen aus Netzentgelten, Steuern, Abgaben und Umlagen, die sich nicht ohne Weiteres reduzieren lassen. Genau aus diesem Grund setzt die Bundesregierung nun gezielt beim Arbeitspreis an. Durch die Absenkung auf 5 ct/kWh soll ein Preissignal gesetzt werden, das die internationale Wettbewerbsfähigkeit stromintensiver Unternehmen stärkt und gleichzeitig Investitionen in Energiewende-Technologien beschleunigt.
Ausgestaltung des Industriestrompreises ab 2026
Formal wird der neue Industriestrompreis rückwirkend greifen. Unternehmen können die finanzielle Unterstützung erstmals im Jahr 2027 für das Jahr 2026 rückwirkend beantragen und gehen finanziell in Vorleistung. Die Förderung ist auf insgesamt drei Jahre ausgelegt – also auf die Zeiträume 2026, 2027 und 2028 – und läuft anschließend aus. Ausgezahlt wird jedoch noch bis 2030, sodass aus administrativer Sicht ausreichend Puffer bleibt.
Der Bund stellt hierfür erhebliche Mittel bereit, allerdings in sinkender Höhe: 2026 sollen 1,5 Mrd. Euro aus dem Klimatransformationsfonds (KTF) zur Verfügung stehen, in den beiden Folgejahren jeweils 800 Mio. Euro. Das Konzept ist bewusst degressiv ausgestaltet, um die Unternehmen zu entlasten. Zugleich soll es aber klare Anreize geben, die Energieversorgung strukturell nachhaltiger aufzustellen. Berechnungsgrundlage ist der durchschnittliche Börsenstrompreis. Liegt dieser oberhalb von 50 Euro je Megawattstunde, greift die Differenzzahlung bis zur Marke von 5 ct/kWh, jedoch nur für definierte Verbrauchsanteile.
Welche Unternehmen Anspruch haben
Adressiert werden ausdrücklich nur jene Industriezweige, die als besonders strom- und handelsintensiv gelten. Grundlage ist die sogenannte BesAR-Liste 1 des Energieeffizienzgesetzes (EnFG), also die EU-Sektoren mit „erheblichem Verlagerungsrisiko“. Für die Förderfähigkeit müssen Handelsintensität und Stromintensität zusammengenommen mindestens 2 Prozent erreichen und beide Werte jeweils über 5 Prozent liegen.
Diese vergleichsweise strenge Definition begrenzt die Beihilfen auf 91 Wirtschaftssektoren und Teilsektoren, zu denen unter anderem große Teile der chemischen Industrie, die Metallverarbeitung, die Produktion von Zement, Glas, Keramik, Batteriezellen und Halbleitern, die Gummi- und Kunststoffverarbeitung, Teile der Papierindustrie sowie bestimmte Bereiche des Maschinenbaus und der Rohstoffgewinnung zählen. Für sie ist die Energiepreisfrage ein zentraler Standortfaktor – und damit das Kernargument für die Einführung des Industriestrompreises.
Welche Bedingungen Unternehmen erfüllen müssen
Eine zentrale Maßgabe ist die Mengenbegrenzung. Die vergünstigten 5 ct/kWh gelten nicht für den gesamten Verbrauch eines Unternehmens, sondern nur für definierte Anteile, die im Zeitverlauf sinken. Während im Jahr 2026 noch „mehr als 50 Prozent“ des Verbrauchs gefördert werden können, sind es 2027 exakt 50 Prozent und 2028 ein reduzierter Anteil. Insgesamt erhält demnach ein Unternehmen während der dreijährigen Laufzeit des Industriestrompreises im Schnitt Zuschüsse für 50 % ihre Gesamtstromverbrauchs, so dass 5 ct/kWh erreicht werden.
Parallel gelten bestimmte Ausschlüsse. Besonders wichtig: Die Förderung kann nicht mit der bestehenden Strompreiskompensation kombiniert werden. Unternehmen müssen sich entscheiden, welche der beiden Beihilfearten für sie wirtschaftlich sinnvoller ist. Andere Entlastungen – etwa reduzierte Netzentgelte nach § 19 StromNEV, Stromsteuerentlastungen oder Umlagebefreiungen – dürfen hingegen weiterhin genutzt werden.
Damit die staatliche Förderung nicht nur kurzfristige Kostenvorteile schafft, sondern langfristige Effekte für das Energiesystem erzeugt, ist sie an weitere Bedingungen geknüpft. Besonders relevant ist die Investitionspflicht. Unternehmen müssen 50 % der erhaltenen Beihilfen innerhalb von 48 Monaten in Projekte investieren, die einen messbaren Beitrag zur Senkung der Kosten des Stromsystems leisten. Gemeint sind vor allem Investitionen in erneuerbare Energieerzeugung, Almacenamiento en batería oder Maßnahmen zur Eficiencia energética.
Wer sogar 80 % der Förderung in diese Bereiche lenkt, kann zusätzlich einen Bonus von 10 % der eigentlichen Beihilfe erhalten. Die Förderung ist daher nicht nur ein kurzfristiger Preisdeckel, sondern ein Transformationsinstrument, das Unternehmen zu nachhaltigen Investitionen motivieren soll.
Einordnung: Was bedeutet der Industriestrompreis ab 2026 für die Praxis?
Mit dem Industriestrompreis ab 2026 setzt die Bundesregierung ein wichtiges, allerdings zeitlich begrenztes industriepolitisches Signal. Einerseits wird der unmittelbar wettbewerbsrelevante Arbeitspreis für besonders exponierte Industrien leicht abgesenkt. Andererseits zwingt die Förderung Unternehmen dazu, sich aktiv an der Modernisierung des Energiesystems zu beteiligen, indem sie in erneuerbare Erzeugung, Speicher oder Effizienzprojekte investieren.
Gerade diese Kopplung aus Preisentlastung und Transformationsdruck macht das Modell interessant: Es bietet kurzfristige Entlastung in Zeiten hoher Energiekosten, schafft aber gleichzeitig ein Investitionsumfeld, das langfristig zu stabileren und niedrigeren Stromkosten führen kann – sowohl für die Industrie als auch für das Gesamtsystem.
Für viele Unternehmen wird entscheidend sein, wie administrativ einfach die Antragstellung gestaltet wird, wie verlässlich die Mittel bisheriger Förderprogramme bleiben und ob der Industriestrompreis ab 2026 möglicherweise zu einem dauerhaften Standortinstrument weiterentwickelt wird.