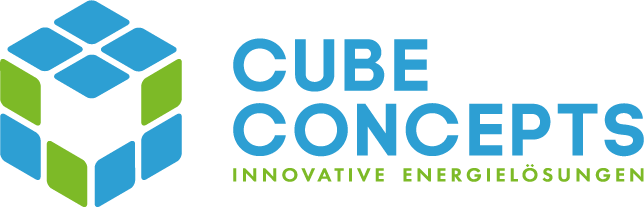Mit der Vorstellung des aktuellen Monitoring-Berichts hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche eine neue Debatte über Tempo, Kosten und Richtung der deutschen Energiepolitik eröffnet. Die vom Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) und dem Beratungsunternehmen BET erstellte Studie zeigt, dass die Herausforderungen deutlich größer ausfallen könnten als bislang angenommen.
Na stránkách Energiewende steht demnach vor einem Stresstest. Vor allem beim künftigen Strombedarf a notwendigen Netzausbaukosten liegen die Prognosen im Gegensatz zu anderen Studien weit auseinander, während gleichzeitig die staatlichen Förderungen für Erneuerbare Energien zurückgefahren werden sollen.
Die Bundesregierung setzt dabei auf einen Kurswechsel: weniger klassische Förderung, stattdessen mehr Marktmechanismen und Investitionssicherheit über Differenzverträge. Gleichzeitig sollen neue Gaskraftwerke als Brückentechnologie gebaut werden. Damit stehe die Energiewende an einem Scheidepunkt, so Katharina Reiche.
Der Monitoring-Bericht des BMWK von EWI & BET
Der neue Monitoring-Bericht des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) und des Beratungsunternehmens BET liefert zentrale Kennzahlen zur Energiewende. Demnach wird der deutsche Stromverbrauch bis 2030 auf 600 bis 700 Terawattstunden (TWh) geschätzt – also deutlich niedriger als in anderen Studien. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche rechnet sogar mit einem Bedarf „im niedrigen 600er-Bereich“. Begründet wird diese Einschätzung mit den stagnierenden Verkaufszahlen von E-Autos und Wärmepumpen sowie der schleppenden Elektrifizierung der Industrie.
Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf den Kosten für den Netzausbau bis 2045. EWI und BET kalkulieren mit 731 Mrd. €. Dabei entfallen 430 Mrd. € für den Ausbau der Übertragungsnetze und 301 Mrd. € für die Verteilnetze. Damit liegen die Schätzungen rund 176 Mrd. € über den bisherigen Annahmen der Bundesnetzagentur, die von insgesamt nur 555 Mrd. € ausgegangen war. Ausschlaggebend dafür sei vor allem die stärkere Dezentralisierung der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien. Wind- und Solarkraftwerke entstünden zunehmend in Regionen, die bislang nicht auf große Mengen Strom ausgelegt waren. Um diese Erzeugungskapazitäten in das Gesamtsystem zu integrieren, sehen die Autoren sowohl beim Übertragungsnetz als auch im Verteilnetz erheblich höheren Investitionsbedarf.
Alternative Studien im Vergleich
Die Einschätzungen von EWI und BET stehen nicht allein, sondern reihen sich in eine Reihe von Analysen ein, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden. Dabei wird deutlich, dass sich die Prognosen zum künftigen Stromverbrauch in Deutschland erheblich unterscheiden.
Na stránkách Federální síťová agentura rechnet in ihrer Studie „Versorgungssicherheit Strom“ mit einem Bedarf von 725 Terawattstunden bis 2030. Damit liegt sie deutlich über den Annahmen des Monitoring-Berichts. Noch weiter gehen die Berechnungen von Enervis, das im Auftrag von Greenpeace und Green Planet Energy verschiedene Szenarien untersucht hat. Selbst im Szenario eines verlangsamten Ausbaus erneuerbarer Energien prognostiziert Enervis einen Verbrauch von 758 TWh, während im Referenzszenario Werte von über 800 TWh erwartet werden. Agora Energiewende bewegt sich mit einer Schätzung von 701 TWh im Mittelfeld. Sie betont, dass eine ambitionierte Klimapolitik nur mit einem dynamischen Ausbaupfad für Wind- und Solarenergie erreicht werden kann. Beide Studien warnen vor Risiken einer Verlangsamung des EE-Ausbaus.
Um die Klimaneutralität Deutschlands gemäß Pariser Abkommen zu erlangen, wurde ursprünglich das EEG dahingehend angepasst. Verschiedene Studien gehen von folgenden Werten aus, damit der Zielpfad eingehalten wird:

Vergleicht man nun die aktuellen Studien zur Energiewende aus September 2025, variieren sie doch deutlich und weichen schon für das Berechnungsjahr 2030 voneinander ab.

Gemeinsamkeiten & Unterschiede der Studien zur Energiewende
Trotz der teils erheblichen Unterschiede in den Prognosen für 2030 gibt es zwischen den Analysen von EWI/BET, der Bundesnetzagentur, Enervis und Agora Energiewende einen klaren Konsens. Der EE-Ausbau darf nicht gebremst werden, um die Klimaziele und Versorgungssicherheit zu erreichen. Einigkeit besteht auch darin, dass die Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Gebäuden langfristig zu einem steigenden Strombedarf führt.
Unterschiede zeigen sich vor allem in der Höhe der Verbrauchsprognosen. Während EWI und BET mit 600 bis 700 TWh eher konservativ kalkulieren, gehen Enervis und teilweise auch die Bundesnetzagentur von deutlich höheren Werten bis über 800 TWh aus. Ebenso variieren die Annahmen zur Geschwindigkeit der Elektrifizierung und zu den Effizienzgewinnen in Wirtschaft und Haushalten.
Die politischen Handlungsempfehlungen leiten sich entsprechend unterschiedlich ab. BNetzA, Enervis und Agora drängen daher auf einen beschleunigten EE-Ausbau mit Speichern, um die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten. Das BMWK argumentiert auf Basis des EWI/BET-Berichts für mehr Gas- und Importstrom a Anpassung der Förderinstrumente. Diese seien für den Ausbau erneuerbarer Energien nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen sollen die Beihilfen schrittweise zurückgefahren und stärker an den europäischen Rahmen angepasst werden. Im Zentrum steht dabei die Einführung von Differenzverträgen (Contracts for Difference), die künftig eine zentrale Rolle spielen sollen.
Differenzverträge (Contracts for Difference, CfD) als Mittel der Wahl
Um Investitionssicherheit für Erzeuger zu gewährleisten, die Kosten für Verbraucher zu begrenzen und EE-Förderungen an die europäischen Leitlinien anzupassen, möchte Reiche auf Differenzverträge setzen. Diese sollen die gleitende Marktprämie künftig ablösen.
Das Grundprinzip eines CfDs besteht darin, dass ein EE-Kraftwerk bzw. Energieerzeuger einen Festpreis pro erzeugter Kilo- oder Megawattstunde erhält. Dieser Referenzpreis (Strike Price) wird bei der Planung eines EE-Kraftwerkes langfristig, meist im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens, festgelegt und liegt in der Regel höher als der aktuelle Marktpreis. Während des Betriebs erhält der Betreiber einen finanziellen Ausgleich, sobald der Marktpreis unter den Strike Price fällt. Im umgekehrten Fall muss der Betreiber die Differenz zurückzahlen.

Differenzsysteme kommen zurzeit beispielsweise in Großbritannien, Frankreich oder Spanien zum Einsatz und haben üblicherweise Laufzeiten zwischen zwölf bis zu 25 Jahren. Varianten des Modells gibt es auch in Dänemark und Griechenland, wo sie zu einer deutlichen Steigerung des EE-Ausbaus geführt haben. Kritisch diskutiert wird dort die richtige Bemessung von Referenzpreisen und die Gefahr von Überförderung oder Unteranreizen für Innovation.
Co bude dál?
Der Monitoring-Bericht von EWI und BET ist kein Endpunkt, sondern der Auftakt für weitere politische Diskussionen. In den kommenden Monaten werden die Ergebnisse in den zuständigen Fachausschüssen des Bundestages und im Bundesrat beraten. Parallel dazu prüft die Bundesnetzagentur die Zahlen kritisch und gleicht sie mit den eigenen Szenarien ab. Als zunehmend eigenständigere Regulierungsbehörde trägt sie dabei eine Schlüsselrolle, die durch das EuGH-Urteil aus 2021 bekräftigt wurde.
Die BNetzA genehmigt die Netzentwicklungspläne der Übertragungsnetzbetreiber und legt damit fest, welche Investitionen in den kommenden Jahren tatsächlich umgesetzt werden. Auch bei der Ausgestaltung neuer Förderinstrumente wie den Differenzverträgen wird sie eine wichtige Rolle spielen, um deren Vereinbarkeit mit dem bestehenden Markt- und Regulierungsrahmen sicherzustellen.
Offen bleibt zudem, wie sich die tatsächliche Nachfrage nach Strom entwickelt. Sollte die Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr, Wärme und Industrie schneller voranschreiten, als es die konservativen Annahmen von EWI und BET unterstellen, könnte der Verbrauch deutlich über die „niedrigen 600er Werte“ hinauswachsen. In diesem Fall müssten Ausbauziele, Netzplanung und Fördermechanismen kurzfristig angepasst werden, um Versorgungslücken und steigende Importabhängigkeit zu vermeiden.
Sicher ist: Die Energiewende bleibt ein dynamischer Prozess, in dem politische Rahmenbedingungen laufend nachjustiert werden müssen. Der Monitoring-Bericht liefert dafür wichtige Daten und Impulse. Wie erfolgreich er in konkrete Maßnahmen übersetzt wird, hängt jedoch nicht nur vom politischen Willen der Bundesregierung ab, sondern auch von der Bewertung durch die Bundesnetzagentur und der Geschwindigkeit des parlamentarischen Gesetzgebungsprozesses.