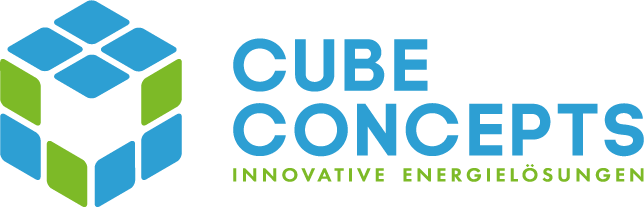Wie verhalten sich eigentlich gewerbliche PV-Anlagen bei negativen Strompreisen? Dieses Thema ist äußerst vielschichtig und wird immer dringender. Denn mit der steigenden Zahl an Stunden mit negativen Börsenpreisen (389 im ersten Halbjahr 2025, gegenüber 457 im gesamten Jahr 2024) wächst auch der wirtschaftliche Druck auf Anlagen, deren Strom nicht vollständig selbst verbraucht wird. Umso wichtiger ist es, die Photovoltaik-Anlage konsequent auf den Eigenverbrauch auszurichten. Je höher die Eigenverbrauchsquote, desto stabiler und unabhängiger ist der Betrieb – auch bei stark schwankenden oder negativen Strompreisen.
Warum es immer häufiger zu negativen Strompreisen kommt
Negative Strompreise entstehen vor allem dann, wenn viel erneuerbarer Strom – insbesondere aus Wind- und PV-Anlagen – ins Netz eingespeist wird, die Nachfrage aber gleichzeitig niedrig ist. Typische Situationen sind sonnige Wochenenden oder Feiertage, an denen der Stromverbrauch in der Industrie stark zurückgeht. Eine ausführliche Analyse der Ursachen, Marktmechanismen und regulatorischen Entwicklungen finden Sie in unserem Beitrag Záporné ceny elektřiny jako výzva a příležitost.
Was bedeutet das für Betreiber von PV-Anlagen?
Für Betreiber von PV-Anlagen bringen negative Strompreise neue Herausforderungen mit sich. Dies gilt insbesondere dann, wenn der erzeugte Strom nicht vollständig selbst verbraucht, sondern ins Netz eingespeist wird. Was das konkret bedeutet, hängt stark von der technischen Ausstattung und der Vermarktungsform der Anlage ab:
- Nicht regelbare PV-Anlagen schalten bei negativen Preisen entweder komplett ab – mit dem Nachteil, dass das Unternehmen dann seinen gesamten Strombedarf aus dem Netz beziehen muss –, oder sie bleiben am Netz und zahlen im ungünstigsten Fall für ihre Einspeisung. Ein Betrieb solcher ungeregelter PV-Anlagen wird daher immer unrentabler.
- Pro EEG-geförderte Anlagen gilt seit Februar 2025 gemäß Solarpaket I: Bereits ab der ersten Stunde mit negativen Preisen entfällt die Einspeisevergütung. Die Anlage regelt in diesem Fall ab. Die entgangenen Stunden verlängern allerdings den EEG-Förderzeitraum entsprechend, was jedoch die Wirtschaftlichkeit oder den ursprünglich kalkulierten ROI verwirft.
- Regelbare Anlagen sind klar im Vorteil: Sie können gezielt nur die Einspeisung ins Netz reduzieren, während der Eigenverbrauch im Unternehmen weiter aufrechterhalten wird. So lässt sich die Anlage auch in Phasen negativer Marktpreise sinnvoll nutzen.
- Unternehmen mit Velké bateriové úložné systémy haben eine zusätzliche Option: Sie können den überschüssigen Strom zwischenspeichern und zu einem späteren, wirtschaftlich sinnvollen Zeitpunkt selbst verbrauchen oder einspeisen.
Wirtschaftliche & regulatorische Konsequenzen für PV-Anlagenbetreiber
Die zunehmende Häufung negativer Strompreise bringt für Betreiber gewerblicher PV-Anlagen neue wirtschaftliche und regulatorische Herausforderungen mit sich. Generell sind größere Anlagen, die der Direktvermarktungspflicht unterliegen, betroffen. Eine SAPB-Studie belegt jetzt, dass auch trotz extremer negativer Preise von bis zu -500 €/MWh nur ein Bruchteil der direktvermarkteten Anlagen tatsächlich abgeregelt. Dies sei vor allem auf technische und vertragliche Hürden zurückzuführen, belaste das Stromnetz und treibe die Kosten für die Redispatch-Maßnahmen in die Höhe. Selbst die Tatsache, dass EEG-Anlagen seit Februar 2025 ab der ersten Stunde negativer Preise keine Einspeisevergütung mehr erhielten, habe kaum für Entlastung gesorgt.
So stehen Betreiber nicht regelbarer Anlagen und starren Stromtarifen vor der Entscheidung entweder die Anlage komplett abzuschalten und teuren Netzstrom zu beziehen oder die Anlage weiterzubetreiben und für die Einspeisemenge zuzuzahlen. In beiden Fällen belastet es die Wirtschaftlichkeit des Betriebes enorm. Dem gegenüber stehen sich Betreiber regelbarer Anlagen wesentlich besser: Sie können ihre Netzeinspeisung gezielt reduzieren, während der Eigenverbrauch weiterhin möglich bleibt.
Flexibilität entscheidet über die Wirtschaftlichkeit
Für Betreiber ergibt sich damit eine klare Unterscheidung:
- Nicht regelbare Anlagen ohne moderne Steuertechnik haben nur zwei Optionen: Entweder die komplette Abschaltung – was eine vollständige Deckung des Strombedarfs über Netzbezug notwendig macht – oder ein Weiterbetrieb mit dem Risiko, für die eingespeiste Strommenge zahlen zu müssen. In beiden Fällen leidet die Wirtschaftlichkeit massiv.
- Regelbare Anlagen mit intelligenter Steuerung können gezielt nur die Einspeisung ins Netz reduzieren, während der Eigenverbrauch im Unternehmen weiterhin aufrechterhalten bleibt. Das verbessert nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern reduziert auch die Risiken durch volatile Marktpreise.
- Anlagen mit Speicher bieten zusätzliche Handlungsspielräume: Überschüssiger Strom kann zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt oder verkauft werden. Die Kombination aus Eigenverbrauch, Abregelung und Speicher ist aktuell die wirtschaftlich und netzdienlichste Betriebsweise.
Rolle der Direktvermarkter bei der Abregelung
Direktvermarkter reagieren sehr unterschiedlich auf negative Strompreise – je nach Vertragsgestaltung, technischer Infrastruktur und wirtschaftlichem Spielraum:
- Komplettabregelung ist selten: Selbst bei stark negativen Preisen werden Anlagen fast nie vollständig abgeschaltet. Marktanalysen zeigen, dass im Durchschnitt nur rund 10 % der Anlagen in der Direktvermarktung tatsächlich abgeregelt werden.
- Gezielte Reduktion der Netzeinspeisung ist Regelfall: Statt einer vollständigen Abschaltung wird meist nur die Einspeisung ins Netz reduziert – in Stufen, z. B. auf 50–60 % der Nennleistung. Produktion und Eigenverbrauch laufen weiter. Voraussetzung hierfür ist meist ein Smart Meter mit Steuerbox.
- Rechtliche & technische Hürden bestehen weiter: Viele Bestandsanlagen verfügen nicht über die nötige Steuertechnik oder sind in der Direktvermarktung vertraglich unflexibel eingebunden. Zudem fehlen einheitliche Standards für eine schnelle, marktorientierte Steuerung.
Kurzum: Die wirtschaftlichen Folgen negativer Strompreise treffen vor allem Betreiber unflexibler Anlagen. Wer frühzeitig in Regelbarkeit, Speicherlösungen und intelligentes Energiemanagement investiert, kann dagegen nicht nur Risiken vermeiden, sondern auch neue Erlöspotenziale erschließen – etwa durch dynamische Vermarktungsstrategien, Flexibilitätsmärkte oder optimierten Eigenverbrauch.
Strategien & Optionen für den Betrieb von PV-Anlagen bei negativen Strompreisen
Die Entwicklung hin zu häufigeren negativen Strompreisen macht deutlich: PV-Anlagen müssen zukünftig nicht nur Strom erzeugen, sondern auch systemdienlich a Flexibilní betrieben werden. Für Betreiber ergeben sich daraus mehrere strategische Handlungsfelder, um wirtschaftlich stabil zu bleiben und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
Regelbarkeit & Fernsteuerbarkeit sicherstellen
Für alle Anlagen mit (teilweiser) Einspeisung ins Netz wird die Regelbarkeit entscheidend: Nur wer gezielt und automatisiert auf Preissignale reagieren kann, vermeidet Verluste und erfüllt die Anforderungen der Direktvermarktung. Moderne Wechselrichter und EMS ermöglichen eine stufenweise oder dynamische Drosselung der Netzeinspeisung – bei gleichzeitigem Weiterbetrieb für Eigenverbrauch oder Speicherladung.
Zusammenarbeit mit dem Direktvermarkter optimieren
Ein enger Austausch mit dem Direktvermarkter ist essenziell. Nur wenn dieser über die technischen Voraussetzungen und Handlungsspielräume der Anlage informiert ist, kann eine flexible und marktorientierte Fahrweise abgestimmt werden. Betreiber sollten ihre Verträge prüfen und hinterfragen, wie stark und wie schnell der Direktvermarkter auf negative Preise reagiert – und welche Möglichkeiten zur Abregelung oder Speichersteuerung bereits integriert sind.
Speicherintegration prüfen
Batteriegroßspeicher bieten die Möglichkeit, Überschüsse zwischenzuspeichern und in späteren Zeitfenstern mit höheren Preisen selbst zu verbrauchen oder einzuspeisen. Insbesondere für mittelgroße bis große Gewerbeanlagen mit tageszeitlich schwankendem Verbrauch ist dies ein zunehmend wirtschaftlich sinnvoller Weg – vor allem, wenn Förderprogramme oder steuerliche Vorteile genutzt werden können.
Fokus auf Eigenverbrauch erhöhen
Ein wichtiger Hebel bleibt der direkte Eigenverbrauch: Je höher der Anteil des erzeugten Stroms, der unmittelbar im eigenen Betrieb genutzt wird, desto weniger ist die Anlage von negativen Börsenstrompreisen betroffen. Eine Lastverschiebung – z. B. durch flexible Steuerung von Produktionsprozessen oder Ladeinfrastruktur – kann helfen, den Eigenverbrauch gezielt zu maximieren.
Frühzeitige Anpassung an regulatorische Entwicklungen
Mit Blick auf künftige Änderungen bei Einspeisevergütung, Netzentgelten und Flexibilitätsanforderungen (z. B. § 14a EnWG, zukünftige Redispatch-Anforderungen, Netzentgeltreformen) ist es ratsam, frühzeitig in Transparenz und Anpassungsfähigkeit zu investieren. Auch die Einführung dynamischer Netzentgelte und zeitvariabler Einspeisetarife wird PV-Anlagen in Zukunft stärker unter Druck setzen – oder gezielt belohnen, wenn sie systemdienlich betrieben werden.
Perspektiven & Ausblick für PV-Anlagen bei negativen Strompreisen
Die steigende Zahl an Stunden mit negativen Strompreisen ist kein kurzfristiges Phänomen – sondern Ausdruck eines tiefgreifenden Strukturwandels im Strommarkt. Photovoltaik-Anlagen sind ein zentraler Baustein der Energiewende, aber sie müssen sich zunehmend an veränderte Marktmechanismen und regulatorische Rahmenbedingungen anpassen.
Vom Einspeiser zum flexiblen Marktteilnehmer
Die klassische Rolle der PV-Anlage als reiner Stromlieferant wird abgelöst durch eine neue Erwartungshaltung: PV-Anlagen sollen künftig flexibel und netzdienlich betrieben werden. Dies bedeutet, dass sie bei negativen Strompreisen die Einspeisung automatisiert stoppen. In solchen Phasen sollten Betreiber bzw. Unternehmen bestenfalls sogar in der Lage sein, zusätzlichen Strom aus dem Netzt aufzunehmen.
Dynamische Strommärkte & neue Geschäftsmodelle
Im Zuge der Strommarktreform gewinnen dynamische Preissignale, flexible Tarife und kurzzeitige Steuerbarkeit an Bedeutung. Durch PV-Anlagen in Kombination mit Speichern und intelligentem Energiemanagement entstehen neue Geschäftsmodelle, etwa zeitvariable Onsite-PPAs oder Speicher-Contracting mit Marktintegration. So werden Spot-, Flexibilitäts- und Kapazitätsmärkte oder netzdienliche Produkte für Betreiber zunehmend interessanter.
Risiken bei Untätigkeit – Chancen für Pioniere
Betreiber, die ihre Anlagen nicht rechtzeitig für die neue Marktlogik ertüchtigen, riskieren wirtschaftliche Verluste. Diese entstehen durch entgangene Erlöse, verpflichtende Abregelungen oder neue Abgaben bei netzbelastendem Verhalten. Gleichzeitig eröffnet sich ein neues Chancenfeld für jene, die frühzeitig in Flexibilität investieren. Präzisere Reaktionen auf Preissignale, kombinierte Speicherlösungen, sektorübergreifende Nutzung (z. B. PV & E-Mobilität) und die Positionierung als systemdienlicher Stromakteur sind lukrative Felder.
Langfristige Perspektive: Lokale Strommärkte & sektorübergreifende Integration
Mit zunehmender Digitalisierung und Dezentralisierung wird auch die regionale Vermarktung von PV-Strom attraktiver. Möglich ist dies durch lokale Stromgemeinschaften, bidirektionale Netze oder direkte Lieferverhältnisse (Onsite-PPA). Langfristig wird die Rolle von PV-Anlagen über den Strommarkt hinausreichen: Sie werden integraler Bestandteil vernetzter Energiesysteme, die Strom, Wärme, Mobilität und Speicher intelligent verknüpfen.
Závěr
Die Zahl negativer Strompreis-Stunden steigt. Für Betreiber gewerblicher PV-Anlagen bringt das erhebliche wirtschaftliche und technische Herausforderungen mit sich, vor allem wenn der erzeugte Strom nicht vollständig selbst verbraucht wird.
Seit Februar 2025 entfällt bei negativen Preisen die EEG-Vergütung ab der ersten Stunde. Eine Abregelung der Einspeisung wird verpflichtend, während der Förderzeitraum entsprechend verlängert wird. Nicht regelbare Anlagen geraten damit zunehmend unter wirtschaftlichen Druck.
Die Lösung: Eine konsequente Auslegung auf Eigenverbrauch, ergänzt durch Speicherlösungen und eine fernsteuerbare Regeltechnik. So können Betreiber gezielt auf Marktpreissignale reagieren, Eigenverbrauch priorisieren und Verluste vermeiden.
Wer heute in die Flexibilität seiner PV-Anlage investiert, sichert die Wirtschaftlichkeit auch in einem zunehmend volatilen Strommarkt.