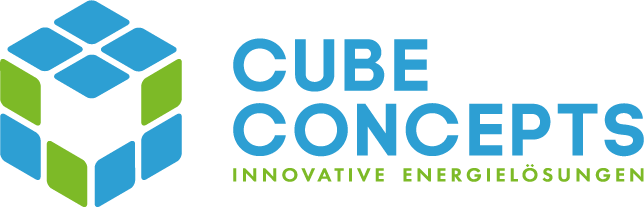Cable Pooling beschreibt das gezielte Zusammenlegen mehrerer Stromerzeugungsanlagen (z.B. Wind, PV, Speicher) an einem gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt. Das zentrale Ziel: Die vorhandene Netzanschlusskapazität wird besser ausgelastet, da nicht jede Anlage zugleich ihre maximale Leistung einspeist. Die Gesetzeslage in Deutschland ermöglicht seit 2025 erstmals ausdrücklich, dass am NVP auch mehr Erzeugungskapazität angeschlossen werden darf, als das Netz eigentlich aufnehmen kann – sogenannte „Überbauung“ oder „Überdimensionierung“.
Netzengpässe & Kapazitätsgrenzen durch klassische Netzplanung
Mit dem rasanten Ausbau der Erneuerbaren Energien stößt das Stromnetz in Deutschland zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen. Zahlreiche neue Photovoltaik- und Windkraftanlagen warten oft monatelang oder gar jahrelang auf einen Netzanschluss. Dies liegt daran, dass die verfügbaren Netzverknüpfungspunkte schon ausgelastet sind und der Ausbau der Netzinfrastruktur nicht Schritt hält. Klassischerweise werden Netzverknüpfungspunkte so ausgelegt, dass jede angeschlossene Anlage ihre maximale Leistung zu jedem Zeitpunkt einspeisen kann. Die Realität sieht jedoch anders aus: Solar- und Windenergie-Anlagen arbeiten wetter- und jahreszeitbedingt – sie erzeugen also selten gleichzeitig ihre maximale Leistung. Dadurch bleibt ein großer Teil der Netzanschlusskapazitäten während eines Großteils des Jahres ungenutzt.
Bessere Auslastung durch Cable Pooling
Diese ineffiziente Nutzung der Infrastruktur führt zu vermeidbaren Wartezeiten bei der Projektumsetzung und erhöhten Kosten. Letztlich kann es auch dazu führen, dass erneuerbare Projekte gar nicht erst realisiert werden. Durch Cable Pooling wird das vorhandene Netz deutlich besser ausgenutzt, denn mehrere Anlagen und Speicher teilen sich die Netzkapazität und gleichen sich gegenseitig aus. Dies belegen auch aktuelle Studien des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) und dem Fraunhofer IEE. Bei einer moderaten Überdimensionierung von Netzverknüpfungspunkten steigt die Auslastung, ohne dass übermäßige Stromüberschüsse entstehen. So lassen sich mehr Projekte schneller, günstiger und effizienter realisieren – ein entscheidender Schritt, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen und die Versorgungssicherheit zu stärken.
Wie funktioniert Cable Pooling?
Im praktischen Betrieb bedeutet Cable Pooling, dass mehrere Stromerzeugungsanlagen – beispielsweise Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher – sich einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt teilen und die vorhandene Netzkapazität gemeinsam und flexibler nutzen können.
Co-Location-Projekte
Bei sogenannten Co-Location-Projekten, bei denen Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) und Batteriespeicher an einem Netzverknüpfungspunkt gekoppelt sind, ist das Überbauen des Netzanschlusses ausdrücklich möglich. In diesem Fall sind die EE-Anlage und der Speicher technisch voneinander getrennt. Sie verfügen jeweils über ein eigenes Messkonzept sowie eine eigene Marktlokation (MaLo). Das wesentliche Merkmal: Der Batteriegroßspeicher kann dann einspeisen, wenn die EE-Anlage die volle Netzkapazität nicht ausschöpft. Der verfügbare Netzanschluss für den Speicher ist also dynamisch und hängt von der aktuellen Einspeisung der EE-Anlage ab. Durch die eigene MaLo kann der Speicher zusätzlich flexibel zum Netzbezug (Graustrom) eingesetzt werden.
Hybridmodelle
Neben dem klassischen Cable Pooling gibt es verschiedene technische und marktliche Ausgestaltungen, wie die Ressourcen gemeinsam genutzt und optimiert werden können. Bei einem Hybridmodell betrachtet man Speicher und die angeschlossene EE-Anlage als ein gemeinsames Gesamtsystem. Dabei steht das wirtschaftliche Optimum im Vordergrund. In der kombinierten Fahrweise kann es sinnvoll sein, die Einspeiseleistung der EE-Anlage gezielt zu drosseln, um dem Speicher Vorrang einzuräumen – etwa, um für den Regelenergiemarkt verfügbar zu sein oder Marktsignale optimal auszunutzen.
EEG-geförderte Anlagen
Für EEG-geförderte PV- oder Windkraftanlagen muss ein spezielles Modell angewendet werden. Dabei sind der Batteriespeicher und die EEG-geförderte EE-Anlage hinter derselben Einspeise-MaLo angeschlossen. Der Unterschied: Der Betrieb ist rein auf erneuerbare Energien ausgelegt – der Speicher darf ausschließlich mit überschüssigem Strom der EE-Anlage geladen werden, ein zusätzlicher Netzbezug, also Laden mit Graustrom, ist ausgeschlossen. Diese Variante entspricht den Fördervoraussetzungen nach EEG und garantiert, dass nur grüne Energie zwischengespeichert und wieder eingespeist wird.
Flexible Anschlussmöglichkeiten mit Cable Pooling
Dank moderner technischer Steuerung, separaten Messkonzepten und klar geregelter Marktprozesse lassen sich heute erhebliche Effizienzgewinne an Netzverknüpfungspunkten erzielen. Somit eröffnen Cable Pooling und verschiedene Optimierungsmodelle flexible Wege, Netzanschlüsse optimal auszulasten und neue Geschäftsmodelle rund um Stromspeicher und Spojení sektorů zu entwickeln.
Rechtlicher Rahmen
Für die rechtliche Absicherung und Planungssicherheit sorgt der aktuelle Gesetzesrahmen, insbesondere das EEG 2023 sowie die Neuregelungen vom 25.02.2025 (§ 8 und § 8a EEG). Diese ermöglichen nun ausdrücklich, dass mehrere Akteure ihr gemeinsames Netzanschlusspotenzial flexibel auslasten und den Netzverknüpfungspunkt besser nutzen. Die Teilnehmer des Cable Poolings profitieren davon, dass sie individuelle, flexible Netzanschlussvereinbarungen direkt mit dem Netzbetreiber schließen können. So werden die technischen und regulatorischen Voraussetzungen geschaffen, damit verschiedene Anlagenbetreiber rechtssicher an einem Netzanschlusspunkt zusammenarbeiten können.
Vorteile des Cable Pooling in der Praxis
In der Praxis bringt Cable Pooling zahlreiche handfeste Vorteile für alle Beteiligten mit sich:
- Der Bau und Betrieb weiterer erneuerbarer Energien-Anlagen wird überhaupt erst dort möglich, wo die bestehende Netzinfrastruktur eigentlich schon ausgereizt wäre.
- Anschlusskosten sinken deutlich, da Transformatoren und Netzverknüpfungspunkte optimal ausgelastet werden. Die Wartezeiten für neue Projekte verkürzen sich erheblich.
- Bestehende Netzanschlüsse werden effizient genutzt, indem sie zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Akteuren optimal ausgelastet werden.
- Weniger Strom muss abgeregelt oder „weggeworfen“ werden, da Speicher und intelligente Steuerungskonzepte die Flexibilität im Netz erhöhen. Das erhöht die Versorgungssicherheit und hilft, die Verfügbarkeit von grünem Strom weiter zu verbessern.
Wie funktioniert Cable Pooling im realen Betrieb?
Ein häufiges Beispiel für Cable Pooling ist die Kombination aus Windpark, Solární park a Velkokapacitní bateriové úložiště an einem gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt. So kann tagsüber überschüssiger Solarstrom im Speicher zwischengelagert und bei geringer Solarstromerzeugung oder hoher Nachfrage wieder abgegeben werden. Während der Mittagsstunden erzeugen die Solarmodule die meiste Energie, während der Windpark zu vielen Tages- und Nachtzeiten einspeist. Dank intelligenter Steuerungssysteme wird sichergestellt, dass die maximale Netzkapazität nie überschritten wird – im Gegenteil: Die drei Komponenten können sich so ergänzen, dass die vorhandene Anschlussleistung über weite Strecken optimal ausgelastet ist.
Auch in Hybrid-Projekten oder Gewerbequartieren wird Cable Pooling genutzt, um verschiedene EE-Anlagen und Speicher flexibel und wirtschaftlich am Netzanschlusspunkt zu steuern und gemeinsam Kosten zu sparen. Die Erfahrungen zeigen: Projekte werden so deutlich effizienter, schneller realisierbar und können einen größeren Beitrag zur Versorgung mit erneuerbarem Strom leisten. Auch ohne aufwendigem Netzausbau ist die vorhandene Netzkapazität wetter- und tageszeitabhängig auf diese Weise optimal nutzbar.
Herausforderungen und Grenzen des Cable Pooling
Cable Pooling bringt auch Herausforderungen mit sich: Für einen sicheren Betrieb braucht es eine präzise technische Steuerung, klare Messkonzepte und eine enge Abstimmung zwischen allen beteiligten Akteuren. Die Vertrags- und Abrechnungsmodelle können je nach Projektkonstellation komplex werden, insbesondere wenn viele Betreiber zusammenarbeiten.
Auch wenn eine moderate Überbauung des Netzanschlusses meist wirtschaftlich sinnvoll ist, gibt es eine Grenze. Verschiedene Studien zeigen: Eine Überbauung von Netzverknüpfungspunkten auf 150 % der ursprünglichen Anschlussleistung funktioniert in der Praxis mit minimalen Verlusten. Selbst eine Erhöhung auf bis zu 250 % ist in vielen Fällen realisierbar – allerdings steigt mit wachsender Überbauung der Anteil von Strom, der abgeregelt werden muss, da die Summe der Erzeugungsspitzen seltener komplett ins Netz eingespeist werden kann. In diesen Fällen helfen Speicher und alternative Flexibilitätslösungen, aber nicht jeder Standort kann dieses volle Potenzial dauerhaft ausschöpfen.
Ausblick & Fazit
Cable Pooling ist ein wichtiger Baustein, um die Energiewende in Deutschland schneller und kostengünstiger voranzubringen. Mit der Möglichkeit, Netzanschlusspunkte deutlich zu überbauen und mehrere Anlagen effizient zu koppeln, wird der Netzausbau entlastet und der Zubau erneuerbarer Energien beschleunigt. Gleichzeitig eröffnen sich neue Geschäftsmodelle, insbesondere durch die Integration von Speichern und flexiblen Technologien wie Sektorenkopplung.
Zukünftig werden digitale Steuerungssysteme und smarte Messkonzepte die Umsetzung weiter erleichtern und die Netzflexibilität erhöhen. Auch die Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern, Anlagenbetreibern und Marktakteuren wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Trotz technischer und regulatorischer Herausforderungen verspricht Cable Pooling eine deutlich verbesserte Netzauslastung, reduzierte Ausbaukosten und eine höhere Versorgungssicherheit.
Fazit: Cable Pooling macht vorhandene Netzressourcen besser nutzbar und schafft die Voraussetzungen, um den steigenden Bedarf an Netzanschlüssen für Erneuerbare Energien effizient zu bedienen. Damit ist es ein Schlüsselthema für ein nachhaltiges und zukunftssicheres Energiesystem.