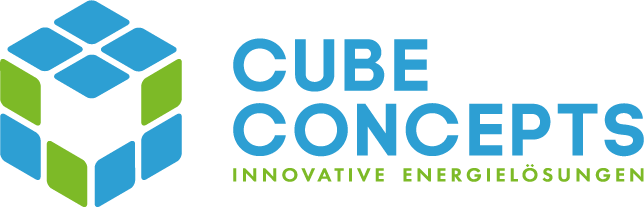Bei einigen gewerblichen Fotovoltaické systémy besteht ein oft übersehenes Risiko: Wenn eine Abregelung der Anlage technisch nur am Wechselrichter möglich ist, kappt der Netzbetreiber bei Netzengpässen nicht nur die Einspeisung ins öffentliche Netz – sondern auch den Vlastní spotřeba. Das führt dazu, dass selbst produzierter Solarstrom komplett ungenutzt bleibt, obwohl er vor Ort verbraucht werden könnte.
Wie relevant das Thema ist, zeigen die aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur: 2024 mussten die Netzbetreiber Netzengpassmanagement-Maßnahmen mit einem Volumen von gut 30.000 Gigawattstunden ergreifen. Die Abregelung von Photovoltaik-Anlagen stieg dabei auf knapp 1.400 Gigawattstunden – ein Plus von fast 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Haupttreiber waren der massive Zubau an PV-Leistung und die außergewöhnlich hohe Sonneneinstrahlung im Sommer 2024.
Auch wirtschaftlich ist das kein Randthema: Die Gesamtkosten des Netzengpassmanagements beliefen sich 2024 auf 2,8 Milliarden Euro. Allein für die Abregelung von Erneuerbaren flossen 554 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen – trotz sinkender Großhandelspreise. Für Betreiber heißt das: Wer keine technische Lösung für eine Abregelung am Einspeisepunkt hat, riskiert unnötige Ertragsverluste und verschenkt Eigenverbrauchspotenzial.
Der rechtliche Rahmen: Klarer Schutz für den Eigenverbrauch
Sowohl europäisches als auch deutsches Recht stellen den Eigenverbrauch von Photovoltaikstrom unter besonderen Schutz. In Artikel 13 der EU-Verordnung zum Elektrizitätsbinnenmarkt (EU) 2019/943 ist festgeschrieben, dass selbst erzeugte Elektrizität, die nicht ins Netz eingespeist wird, grundsätzlich nicht Gegenstand von Redispatch-Maßnahmen oder Abregelungen sein darf. Nur wenn es absolut keine andere Möglichkeit gibt, um die Netzstabilität zu gewährleisten, darf auch der Eigenverbrauch reduziert oder ganz abgeschaltet werden.
Na stránkách Zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG) verpflichtet Betreiber von PV-Anlagen ab einer bestimmten Leistung nach § 9 EEG, technische Einrichtungen vorzuhalten, mit denen der Netzbetreiber die Einspeiseleistung ferngesteuert reduzieren kann. Ziel ist es, Netzengpässe zu vermeiden und die Netzstabilität zu sichern. Dabei ist im EEG jedoch nicht ausdrücklich geregelt, dass nur die Netzeinspeisung betroffen sein darf – die technische Umsetzung bleibt den Betreibern überlassen.
Na stránkách Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ergänzt diese Vorgaben: Nach § 13 Abs. 1 EnWG sind Netzbetreiber befugt, Anlagen bei Gefährdung der Netzsicherheit in ihrer Wirkleistung zu begrenzen oder temporär vom Netz zu trennen. Allerdings gilt auch hier, dass die Maßnahme verhältnismäßig sein muss – also nicht weiter in den Betrieb eingreifen darf, als zur Sicherung des Netzes nötig ist. In der Praxis heißt das: Die Reduzierung sollte nur die Netzeinspeisung betreffen, nicht den Eigenverbrauch.
Fehlt jedoch eine entsprechende technische Umsetzung, kann der Netzbetreiber durch die Abregelung am Wechselrichter ungewollt auch den Eigenverbrauch stilllegen. Das führt nicht nur zu wirtschaftlichen Verlusten, sondern widerspricht auch dem Grundgedanken des EEG, Eigenverbrauch als Beitrag zur Energiewende zu fördern.
Warum der Eigenverbrauch in der Praxis trotzdem betroffen sein kann
Trotz dieser klaren Regelungen kommt es in der Praxis vor, dass Netzbetreiber auch den Eigenverbrauch mit abregeln. Der Hauptgrund dafür liegt in der technischen Umsetzung: Wird ein Wechselrichter direkt heruntergeregelt, reduziert sich die gesamte PV-Produktion – unabhängig davon, ob der Strom ins Netz eingespeist oder vor Ort verbraucht wird.
In vielen Fällen fehlt die messtechnische Trennung zwischen Einspeisung und Eigenverbrauch. Ohne geeignete Steuertechnik können Netzbetreiber nicht exakt bestimmen, welcher Anteil des erzeugten Stroms tatsächlich ins Netz fließt. Hinzu kommt, dass manche Netzbetreiber standardisierte Steuerbefehle einsetzen, die pauschal die Gesamtleistung reduzieren. Das führt dazu, dass der gesetzlich geschützte Eigenverbrauch in der Realität nicht immer unberührt bleibt.
Technische Voraussetzungen für den Schutz des Eigenverbrauchs
Damit der Eigenverbrauch auch im Abregelungsfall verfügbar bleibt, muss die PV-Anlage entsprechend ausgestattet sein. Ein intelligentes Messsystem ist dabei die Grundlage, um zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung zu unterscheiden. Ergänzend sorgt ein Systém řízení spotřeby energiejak se CUBE EfficiencyUnit, dafür, dass der Solarstrom bevorzugt an betriebliche Verbraucher wie Produktionsanlagen, Wärmepumpen oder Ladeinfrastruktur verteilt wird, bevor Überschüsse ins Netz gehen.
Besonders hilfreich sind Velkokapacitní bateriové úložiště, die überschüssigen Strom aufnehmen können, wenn Netzbetreiber die Einspeisung ins Netz begrenzen. So steht dieser Strom zu einem späteren Zeitpunkt für den Eigenverbrauch zur Verfügung. Auch der Wechselrichter spielt eine zentrale Rolle. Moderne Geräte lassen sich so konfigurieren, dass sie die Einspeiseleistung reduzieren, ohne die Versorgung der Eigenverbraucher zu unterbrechen. Ergänzend ermöglichen Mess- und Steuerboxen auf Anlagenseite eine präzise Leistungsregelung, die nur den Netzbezug betrifft.
Praxis bei CUBE CONCEPTS: Abregelung nur am Einspeisepunkt
Bei CUBE CONCEPTS werden alle gewerblichen PV-Anlagen und Batteriegroßspeicher standardmäßig mit der CUBE EfficiencyUnit als EMS projektiert und umgesetzt. Dadurch kann eine Abregelung gezielt am Einspeisepunkt erfolgen – die Versorgung der Eigenverbraucher bleibt unangetastet. Diese technische Umsetzung stellt sicher, dass auch bei Netzengpässen oder Redispatch-Maßnahmen der selbst erzeugte Solarstrom weiterhin für den Betrieb zur Verfügung steht. Für Kunden bedeutet das: maximale Versorgungssicherheit und optimale Nutzung der PV-Anlage – unabhängig von äußeren Netzrestriktionen.
Wie Unternehmen die Abregelung der Eigenversorgung verhindern können
Wer sicherstellen möchte, dass der Eigenverbrauch nicht unnötig eingeschränkt wird, sollte seine PV-Anlage technisch aufrüsten und zumindest ein Einspeise-Management implementieren. Dazu gehört die klare Kommunikation mit dem Netzbetreiber, welche Anlagenleistung ausschließlich für den Eigenverbrauch reserviert ist. Ebenso wichtig ist eine regelmäßige Überprüfung der Anlagenkonfiguration, da sich gesetzliche Vorgaben durch EEG-Novellen und Anpassungen im EnWG verändern können.
Eine lückenlose Dokumentation aller technischen Maßnahmen und der Abstimmungen mit dem Netzbetreiber kann im Konfliktfall entscheidend sein. Sie zeigt nicht nur, dass die Anlage den rechtlichen Anforderungen entspricht, sondern auch, dass alle Möglichkeiten zur Sicherung des Eigenverbrauchs ausgeschöpft wurden.
Lückenhafte Umsetzung sorgt für Abregelung des PV-Eigenverbrauchs
Große gewerbliche PV-Anlagen genießen rechtlich einen klaren Schutz des Eigenverbrauchs. Dennoch zeigt die Praxis, dass dieser Schutz ohne die passende Technik nicht immer wirksam wird. Unternehmen, die auf Eigenversorgung setzen, sollten deshalb frühzeitig in intelligente Messsysteme, Energiemanagement, Speicherlösungen und steuerbare Wechselrichter investieren. CUBE CONCEPTS setzt hier bereits auf die konsequente Umsetzung dieser technischen Standards – und sorgt so dafür, dass der Eigenverbrauch auch in Zeiten von Netzengpässen zuverlässig gesichert ist.