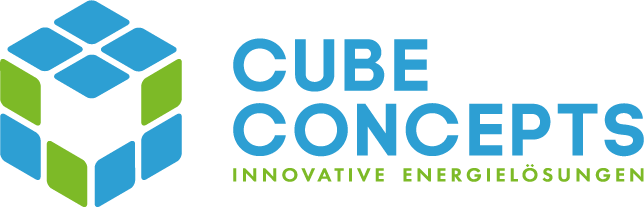Na stránkách Bundesnetzagentur (BNetzA) hat ihren Bericht zur “Versorgungssicherheit Strom” veröffentlicht. Auf 79 Seiten beschreibt sie „Stand und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität“. Der Veröffentlichungszeitpunkt Anfang September 2025 fällt zusammen mit den beiden Studien von Enervis Energy Advisors und Agora Energiewende und dient zugleich als Vorläufer für den anstehenden Monitoringbericht zur Energiewende des BMWK. Entsprechend groß ist die politische Aufmerksamkeit. Während Befürworter den Bericht als Bestätigung für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien sehen, befürchten Kritiker eine politische Vorlage für den Neubau zusätzlicher Gaskraftwerke.
Die Untersuchung betrachtet ebenfalls die Entwicklung des deutschen Stromsystems bis 2035. Sie soll frühzeitig Risiken sowie Handlungsbedarf für eine stabile Stromversorgung aufzeigen. Grundlage ist eine modellgestützte Szenarioanalyse, die den Ausbau erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung des Energieverbrauchs, die Entwicklung von Flexibilitätspotenzialen und den Netzausbau berücksichtigt. Als zentrale Indikatoren für die Versorgungssicherheit dienen die erwartete Zahl der Stunden mit Stromknappheit pro Jahr (LOLE – Loss of Load Expectation) sowie die nicht gedeckte Energiemenge (EENS).
Szenarien des Berichts Versorgungssicherheit Strom im Überblick
Die BNetzA hat in ihrem Bericht zur Versorgungssicherheit Strom zwei Kernpfade analysiert:
- Zielszenario: Ausbau erneuerbarer Energien, Netze und Flexibilitäten verläuft planmäßig nach den im EEG 2023 definierten Ausbauzielen
- Verzögerungsszenario: Ausbauziele werden später erreicht, Flexibilität und Netzinfrastruktur entwickeln sich langsamer.
Ergänzend wurden Sensitivitätsrechnungen durchgeführt, etwa mit Blick auf reduzierte Nachfrageflexibilität oder Engpässe im Netzausbau.
Kernergebnisse des Zielszenarios
Im Zielszenario kommt die BNetzA zu dem wichtigen Ergebnis, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland auch bei ambitioniertem Ausbau der erneuerbaren Energien gewährleistet bleibt – vorausgesetzt, dass
- der Ausbau von Wind- und PV-Anlagen und der Netze wie geplant erfolgt,
- das Flexibilitätspotenzial der neuen Verbraucher wie Wärmepumpen, Elektroautos und Elektrolyseure ausgeschöpft wird,
- und ein substanzieller Zubau steuerbarer Kraftwerkskapazitäten erfolgt, insbesondere Gaskraftwerke, die wasserstofffähig (“H2-ready”) sind.
Bis 2035 wird ein Zubau steuerbarer Kapazitäten von insgesamt 22,4 GW brutto, also ohne Abzug für Stilllegungen, erforderlich. Netto liegt der Wert je nach Szenario in der Spanne von 12,5 bis 25,6 GW. Zugleich steigt der Stromverbrauch durch die Elektrifizierung auf 725 TWh im Jahr 2030 und auf 941 TWh im Jahr 2035. Die installierte Leistung der erneuerbaren Energien, vor allem Wind und PV, wächst weiter stark an. Dies führt zu immer mehr volatil erzeugtem Strom und damit wird Flexibilität des Stromverbrauchs im Gesamtsystem zu einer Schlüsselgröße.
Dabei erzeugen indirekt steuerbare, preissensitive Verbraucher, also unter anderem Industrieprozesse, Elektromobilität und Wärmepumpen in diesem Szenario 79 GW Nachfrageflexibilität bis 2035. Von diesem Potenzial werden ca. 30 GW tatsächlich zur Lastreduktion bei Lastspitzen eingesetzt, was die Notwendigkeit von Backup-Kapazitäten stark senkt. Auch die Indikatoren liegen dabei im Soll. Für 2035 beträgt der LOLE 0,28 h/a und der EENS auf einem sehr niedrigen Niveau.
Kernergebnisse des Verzögerungsszenarios
Im Verzögerungsszenario verschlechtert sich die Versorgungssicherheit deutlich, sobald Ausbauziele für erneuerbare Energien, Netze und Flexibilitäten nicht rechtzeitig erreicht werden. In diesem Fall steigt der Bedarf an steuerbarer Kraftwerksleistung erheblich an. Die BNetzA kalkuliert in ihrem Bericht zur Versorgungssicherheit Strom mit einem Bruttozubau von bis zu 35,5 Gigawatt bis 2035, also deutlich mehr als im Zielszenario. Hintergrund ist, dass ein geringerer EE-Anteil und eine schwächer entwickelte Nachfrageflexibilität größere Lücken im Stromsystem hinterlassen. Diese müssen durch konventionelle Erzeugung abgesichert werden.
Besonders kritisch ist die Entwicklung der Flexibilität. Statt der möglichen 79 Gigawatt werden nur rund 20 Prozent des Potenzials erschlossen. Dies hat zur Folge, dass Lastspitzen weniger gut abgefedert werden können und der Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch häufiger scheitert. Entsprechend verschlechtern sich auch die Versorgungssicherheitsindikatoren. Im Jahr 2030 überschreitet der LOLE mit 4,6 Stunden pro Jahr den geltenden Zuverlässigkeitsstandard von 2,77 Stunden deutlich. Erst 2035 nähert sich der Wert mit 1,77 Stunden wieder einem akzeptablen Niveau.
Die geringere Flexibilität wirkt sich zudem negativ auf die Netzstabilität aus. Zeitweise steigt die Importabhängigkeit spürbar an, während das heimische System nicht genügend Kapazitäten bereitstellt, um Engpässe auszugleichen. Auch die Gefahr von Strompreisspitzen nimmt deutlich zu, da in Knappheitssituationen vermehrt teure Reservekraftwerke eingesetzt werden müssten. Insgesamt zeigt das Verzögerungsszenario, dass ein zögerlicher Ausbau von erneuerbaren Energien, Netzen und Flexibilitäten nicht nur höhere Kosten verursacht, sondern auch die Versorgungssicherheit über Jahre hinweg schwächt.
Kritik am Umgang mit Speichern im Bericht Versorgungssicherheit Strom
Ein zentraler Kritikpunkt am Bericht der BNetzA zur Versorgungssicherheit Strom ist der Umgang mit Stromspeichern. Zwar werden Velkokapacitní bateriové úložiště in der Zusammenfassung erwähnt, in die Modellrechnungen sind sie jedoch nicht eingeflossen. Statt den bereits zugesagten und in großem Umfang geplanten Zubau zu berücksichtigen, geht die Analyse sogar von rückläufigen Kapazitäten aus, bemängelt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar).
Weitere Branchenvertreter sehen dadurch auch ein Risiko verzerrter Ergebnisse und warnen, dass die Bedeutung von Speichern für die Versorgungssicherheit massiv unterschätzt wird. Speichertechnologien könnten konventionelle Kraftwerke teilweise ersetzen und sollten in künftigen Szenarien systematisch berücksichtigt werden, um tragfähige politische Entscheidungen zu ermöglichen.
Handlungsempfehlungen der BNetzA
Auf Basis der Szenarioanalysen empfiehlt die Bundesnetzagentur mehrere Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit langfristig abzusichern. An erster Stelle steht die zügige Umsetzung der im EEG und im Netzausbauplan definierten Ausbaupfade für erneuerbare Energien und Netze. Parallel dazu müsse das volle Flexibilitätspotenzial neuer Verbrauchergruppen – von Elektromobilität über Wärmepumpen bis hin zu industriellen Lasten – erschlossen werden, um das System in Zeiten hoher Volatilität zu stabilisieren.
Darüber hinaus sieht die Behörde einen erheblichen Bedarf an zusätzlicher steuerbarer Kraftwerksleistung, vorzugsweise in Form von wasserstofffähigen Gaskraftwerken. Dabei berücksichtigt sie jedoch nicht die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten, die durch den erhöhten CO₂-Ausstoß entstehen. Um den Markthochlauf abzusichern, spricht sie sich für die Einführung eines Kapazitätsmechanismus aus, der die Vorhaltung dieser Leistung finanziell honoriert. Ergänzend fordert die BNetzA eine bessere Koordination zwischen Strom- und Gasinfrastruktur sowie die Stärkung europäischer Verbundlösungen, um Versorgungslücken im nationalen System durch Importe abfedern zu können.